|
Denk
mal an der Grafen
Der Staatsbürger –
Der Graf
als Heimatgestalt – Grafengeschichte(n) –
Kunstfragen
– Andere
Grafenzeugnisse
– Ein
historisches Detail –
Denkmalnutzung
– Die Standortfrage
– (noch eine Idee)
–
(Artikel als
Pdf-Datei)
Interpretation von Geschichte und ihre offizielle Darstellung sind auch
in Oldenburg von grundlegendem Interesse und
darum immer wieder einmal Gegenstand lebhafter Auseinandersetzungen.
Seit letztem Jahr geht es um die Frage, ob ein der Stadt als Geschenk
angetragenes Graf Anton Günther-Reiterdenkmal öffentlich aufgestellt
werden soll. Der Verfasser vertritt die Ansicht, dass ein solches
Denkmal, wenn es kulturwissenschaftlich eingebettet wird, der
Vermittlung regionaler Geschichte dienen kann und insofern nützlich
wäre.
Zugegeben,
der Verfasser selbst hatte einige Zeit überhaupt nicht an Oldenburger
Geschichtsthemen gedacht, da er seine ganze Aufmerksamkeit einer
befristeten Beschäftigung im Schuldienst widmen musste. Mit
reichhaltiger pädagogischer Erfahrung im Gepäck will man sich nun
vorrangig wieder dem „Geschichtsdienst“ zuwenden – und trifft in der
Stadt Oldenburg auf eine komplexe (perplexe) Diskussion, in der sich
viele Menschen über das Für und Wider, das Wie und Wo eines eventuell
aufzustellenden Denkmals für den Oldenburger Grafen Anton Günther
auseinandersetzen; diesen letzten der mittelalterlichen
Grafenlinie, nach dessen Tode 1667 das Land
Oldenburg erbschaftsweise an die dänische Krone fiel, ehe es 1773 wieder
einen eigenen Regenten aus einer Nebenlinie derselben Familie bekam, die
bis 1918 an der Herrschaft blieb.
Das Denkmal, gemäß Zeitungsfotos ein etwas überlebensgroßer
realistischer Bronzeguss mit dem Barock-Grafen auf seinem Pferd
„Kranich“, ist von einer Gruppe um den früheren Niedersächsischen
Landtagspräsidenten und ehemaligen Oldenburger Oberbürgermeister Horst
Milde privat in Auftrag gegeben, vom inzwischen verstorbenen Oldenburger
Unternehmer Klaus Dirks bezahlt und im Sommer 2011 der Stadt zum
Geschenk angeboten worden. Nach Vorschlag der Stiftergruppe solle das
Denkmal einen Platz beim Oldenburger Schloss bekommen, dem einstigen
Grafensitz. Vertreter aus Wissenschaft und Kunst und dann auch der
Stadtleitung haben das Geschenk aber abgelehnt, mit der Begründung, die
Art der Darstellung sei nicht zeitgemäß. Abschlägig äußerten sich auch
von Milde angerufene hochrangige Landesvertreter. Aus der Oldenburger
Bevölkerung kommen unterschiedliche Stimmen, wobei die Befürworter in
der Mehrzahl zu sein scheinen. Details zum Thema können in den Medien,
v.a. in der Presse verfolgt werden.
Ob leidenschaftliche Befürworter oder Gegner, gleichgültig ist den
Beteiligten die Oldenburger Geschichte sowie die Stadtgestaltung
keinesfalls. Da das auch für den Verfasser gilt, möchte dieser hier
eigene Gedanken zum Grafen-Denkmal nachtragen.

Die Debatte um das
Grafen-Denkmal sorgt für Schlagzeilen. Foto: Martin Teller, 15.2.2012.
Der Staatsbürger
Horst Milde
ist ein überaus freundlicher und durchweg geschätzter und geehrter Mann.
Im Laufe seines politischen Lebensweges hat er sich als Mitglied einer
alten demokratischen Partei intensiv für die res publica im Allgemeinen
und für Oldenburger Belange im Besonderen eingesetzt. Man wünscht sich,
Derartiges am Ende ihrer Laufbahn über mehr Politiker, über mehr Bürger
sagen zu können.
Noch als Pensionär engagiert er sich stark in gesellschaftsrelevanten
Bereichen, was in einem Alter wie seinem noch immer ungewöhnlich ist. Der
Herr wird im April 2012 neunundsiebzig. Sicher hat jeder einzelne von
uns für sein offizielles Handeln auch persönliche Gründe. Der Journalist
Felix Zimmermann hat durchaus respektvoll Mildes biographischen Antrieb
erkundet, wonach dessen Denkmal-Engagement als Entgegenwirken
traumatischer Erinnerung an den Verlust von Heimat zu verstehen sei
(externer Link:
www.Oldenburger-Lokalteil.de).
Milde gehört zu den Heimatvertriebenen des II. Weltkriegs, was in der
Tat seinen früheren Einsatz für ein
Vertriebenendenkmal in Oldenburg erklärt. Dabei hat er die Erfahrung
machen müssen, nachdem er sich mit Kritikern über Gestalt und Standort
jenes Denkmals ausgetauscht und sich letztlich flexibel in beidem
gezeigt hat, dass die Aufstellung noch ganz zuletzt, als eine
Kompromissversion des Denkmals bereits fertiggestellt war, am mangelnden
Gestaltungswillen der Politik scheiterte, sich eines mehrschichtigen
Geschichtsthemas anzunehmen. Gremien können ein gutes
Beratungsinstrument sein, sie können aber auch demokratisch zumeist
bestens legitimiert alles zerreden.
Aufgrund dieser Erfahrung ist Mildes jetziger weitgehender Alleingang
nur allzu verständlich. Geradezu beeindruckend ist die Kühnheit dieses
alten Herren, der eindeutig nicht der Geht-Nicht-Fraktion angehört,
diesmal seiner Stadt eine bereits fertige Lösung für ein Anton
Günther-Denkmal zu präsentieren, das seit ersten Vorschlägen in den
Jahren 1840 und 1844 nicht realisiert worden ist (s. dazu
H. Schmidt: Graf Anton Günther und das oldenburgische
Geschichtsbewußtsein, Old. Jb. Bd. 84).
Ein Politiker weiß trotzdem, dass es dem Erfolg einer Sache dienlich
sein kann, Andere vorab einzubeziehen. Das muss man zwar nicht immer
tun, es hängt von der Situation ab. Hilfreich wäre hier aber z.B. der
Rat von Museumsfachleuten, die zur Gestaltung des landesgeschichtlichen
Charakters einer Grafendarstellung gewiss mehr beitragen können als ein
nachträgliches Njet.
Der Graf
als Heimatgestalt
Mildes
Vorstoß für den in der Bevölkerung bekanntesten und (deshalb?)
beliebtesten Oldenburger Grafen trifft bei ihr wohl darum auf recht
große Gegenliebe, weil dieser auch dort das Gefühl von Heimat bedient
bzw. das einer wie auch immer gearteten alten Zeit, die aus heutiger
global verunsicherter Sicht noch begreiflich und überschaubar schien
(was an Quellenmangel liegen könnte).
Nun hängt von – geschichtlich und weltweit betrachtet keineswegs selbstverständlicher –
Heimatgeborgenheit allein das Wohlbefinden nicht ab. Noch
Grundlegenderes wie Gesundheit, Sicherung der Grundbedürfnisse
Nahrung/Kleidung/Wohnung und Lebensperspektive durch gesichertes
Einkommen stehen ihr voran. Bei den meisten Diskutanten sind diese
Voraussetzungen glücklicherweise gegeben, dennoch ist der Wunsch nach
einer geschichtsindividuell gestalteten Heimat ein Aspekt, der durchaus
Berücksichtigung verdient. Wenn an die spezielle Geschichte Oldenburgs
im Stadtbild durch entsprechend spezielle historische Überreste und
Denkmäler erinnert wird, dient das der Identifikation der Einwohner mit
ihrer Stadt und schärft deren Profil im Vergleich mit anderen Städten.
Da nun der frühneuzeitliche Graf im Heimatbild vieler Bürger als ein
eindeutiges Symbol ihrer Stadt und Region betrachtet wird, taugt er auch
heute noch als (kritisch zu hinterfragender) „Botschafter“ derselben, weshalb er eben von der Stadt
bereits als weicher Standortfaktor genutzt wird, mit dem sich etwa beim
Kramermarktsumzug oder als „Stadtführer“ Stadtmarketing betreiben lässt.
Eine offiziell aufgestellte Grafenfigur könnte diesen
Wiedererkennungswert noch verstärken, wie jeder moderne
Standortpolitiker bedenken wird. Jeder Geschichtsgelehrte wiederum
könnte das dahinterstehende manchmal aber noch diffuse Interesse der
Bevölkerung an Regionalgeschichte als Steilvorlage für historische
Aufklärung nutzen, indem er die Menschen dort abholt, wo sie stehen –
mitunter vor einem geschichtlichen Denkmal.
Grafengeschichte(n)
Wer etwas
Geschichtserfahrung hat, weiß natürlich: Was vor über 170 Jahren
vorgeschlagen wurde, muss heute nicht mehr unbedingt auf der Agenda
stehen. Es kann dies aber noch tun, auch unter geänderten Zeitumständen,
wenn man die Betrachtungsweise darauf ändert.
Das Mitte des 19. Jahrhunderts vorgeschlagene Grafendenkmal,
hauptsächlich mit missverstandenen angeblichen Verdiensten des Grafen
als Förderer des Volkes begründet, war zunächst einmal eindeutig als
Objekt der Herrscherverehrung gedacht. Solch eine Intention passte noch
zum Empfinden vieler wenn auch nicht mehr aller Zeitgenossen der
Monarchie, in einer Demokratie wäre sie wahrlich nicht mehr zeitgemäß,
was Manche entsprechend dem angebotenen Standbild vorwerfen. Man kann
das geplante Denkmal von 1844 aber auch unter Einbettung in die damalige
Kulturepoche gemäß entsprechender Hinweise seiner Unterstützer als ein
Symbol friedlicher Heimat interpretieren, eine Erinnerung an die im
Oldenburger Land verhältnismäßig glimpflich überstandenen schweren
Zeiten des 30jährigen Krieges, mithin als Ausdruck bürgerlicher
Sehnsucht nach Ruhe vor zerstörerischen Kriegen. Denn Mitte des 19.
Jahrhunderts dürfte gerade die Erinnerung an die napoleonischen
Kriegswirren noch sehr präsent gewesen sein. Diese mittlere Zeit des 19.
Jahrhunderts ist schließlich eine ganz andere als die des zweiten
Deutschen Reiches nach 1871 mit seinem preußischen Militarismus. War das
damalige Grafendenkmal bewusst oder unbewusst als beschauliche
Oldenburg-Nabelschau gedacht, als Gegenstand eines Spitzweg-Biedermeier?
Auch so etwas möchte man als psychologisch nicht passend für die
gegenwärtige Moderne bezeichnen, zögert angesichts erst in Gang
kommender Auswirkungen der globalen Finanzvernetzung aber doch mit einem
zu schnellen Urteil.
Wir können derartige Intentionen damaliger Denkmalbefürworter im
Wesentlichen nur aus ihrer Zeit ableiten, können unsererseits aber dem
Anton Günther-Denkmal einen innewohnenden Friedensaspekt nicht
grundsätzlich absprechen. Nur weil sich der unkriegerische Graf zu
Lebzeiten selbst als Friedensfürst verherrlichen ließ, bedeutet das
nicht, dass die Sache im Kern historisch falsch wäre. Friedenspolitik
ist heute aktuell wie eh und je, und an einen zwar absolutistischen
Herrscher zu erinnern, der aber seine Machtmittel dafür einsetzte,
Untertanen und Land nicht im Krieg verheeren zu lassen, sollte heutigen
demokratisch-souveränen Oldenburgern jederzeit möglich sein.
Es wäre ein
Irrtum, ein heutiges Grafen-Denkmal als Ausdruck romantisierender oder
gar politischer monarchischer Gesinnung zu deuten, selbst wenn die
bronzene Grafenpose des Denkmals der aus etlichen Abbildungen sehr
bekannten landesherrlichen Herrschaftsgeste Anton Günthers zu Pferd
gleichkommt. Abgesehen vielleicht von manchen Illustrierten-Träumen
Einzelner spielt unreflektierte Fürstenverehrung im gesellschaftlichen
Bewusstsein keine ausschlaggebende Rolle mehr. Nicht zuletzt weil sich
die kollektive Erinnerung sehr bewusst ist, dass in einer Monarchie
jemand wie Kaiser Wilhelm II. an die Macht kommen kann, der seiner
verantwortungsvollen Aufgabe überhaupt nicht gewachsen war. So etwas
kann zwar auch im heutigen System geschehen, doch demokratisch gewählte
Funktionsträger sind an Amtszeiten und mehrheitlichen Konsens gebunden,
was Revolutionen in Volldemokratien bislang jedenfalls überflüssig
gemacht hat. Dem Verfasser möge allerdings die persönliche Randbemerkung
gestattet sein, dass jemand mit wesentlichen
Verdiensten um die Oldenburger Geschichtswissenschaft unter einem
regierenden Großherzog, also in einer Monarchie, sicherlich nicht um
eine dauerhaft existenzsichernde Anstellung hätte bangen müssen, während
dies in einer Demokratie der Fall sein kann.
Wer aber seine demokratische Grundeinstellung beim bloßen Anblick eines
geschichtlichen Grafen-Denkmals gefährdet sieht, sollte vielleicht
einmal seine eigene Demokratiefestigkeit hinterfragen. (Das gleiche gilt
zuweilen für bauliche Hinterlassenschaften der Nazis, die Manche als
zeitgeschichtliche Denkmäler
ansehen und aus historisch-didaktischen sowie architektur- und
kunstgeschichtlichen Gründen erhalten und wissenschaftlich bearbeiten
wollen, während sich Andere an ihnen machtergreifend als Bilderstürmer
betätigen.) So historisch verständlich antimonarchistische Reflexe sein
mögen: In Europa und Deutschland gehören bürgerliche Kämpfe gegen die
absolute Monarchie ins 18. bis frühe 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert
wird niemand mehr die Macht von Erbmonarchen und Adelsherrschaft
zurückdrängen müssen (allenfalls noch die quasimonarchischer
Autokraten), solange sich die Demokratie ihre rechtlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen und damit ihre Demokraten
erhält. Der Verfasser kann im angebotenen Anton Günther-Denkmal beim
besten Willen keine politische Agitation für ein vordemokratisches
System sehen, sondern nur eine geschichtliche Erinnerung an eine
regional- und stadtgeschichtlich bedeutsame Persönlichkeit.
Kritische
Stimmen weisen zu Recht darauf hin, Graf Anton Günthers Geschichtsrolle
werde in der Bevölkerung oft zu verklärt gesehen, in jüngerer Zeit werde
sie vor allem auf wenige Pferdegeschenke verkürzt, mit denen der Graf
Oldenburg vor feindlichen Truppen gerettet habe. So liest man zum
Beispiel: Anton Günther [...] besaß allein neun Gestüte und verstand
es, durch geschickt platzierte Geschenke seiner begehrten Reitpferde an
[den Kaiser und andere wichtige europäische Herrscher] sein Land aus dem
Dreißigjährigen Krieg herauszuhalten. Den kaiserlichen Marschall Tilly,
der 1623 mit seiner Armee schon bei Wardenburg lagerte, konnte er so mit
einigen Oldenburger Hengsten beschwichtigen, daß er umkehrte und Stadt
und Grafschaft ungeschoren ließ. (Bildband
„Oldenburg“, H. J. Hansen, K. Rohmeier, Oldenburg [1987], S. 87.)
Oldenburger Pferdefreunde mögen stolz auf die Tradition als
Pferdezuchtstandort sein und im Grafen den ideellen Begründer desselben
sehen. Die beschwichtigende Wirkung Oldenburger Hengste wird indes so
groß nicht gewesen sein, wären da nicht des Grafen geschickte
diplomatische Verhandlungen in alle Richtungen, verbunden mit hohen
Geldzahlungen, mit denen er die militärische Neutralität des Landes
Oldenburg bei seinen Verhandlungspartnern erreichte bzw. laufend
sicherte, was während des Krieges seiner Bevölkerung nicht alles aber
immerhin viel Leid erspart hat.
Was den kaiserlichen Heerführer Tilly betrifft, dem es 1623 um raschen
Truppendurchzug und nicht um die Plünderung der Grafschaft Oldenburg
ging, war der von den Pferden kaum so hingerissen, dass er alles andere
vergaß, wie es die verklärende Sage will. Die Pferde haben hauptsächlich
den Charakter eines standesgemäßen diplomatischen Geschenkes, als
automatisch funktionierende Bestechung dürfen sie nicht missverstanden
werden. Denn sie waren sicher nicht allein ausschlaggebend für das
Aufgeben des Durchzugsplanes, da Tilly seine Entscheidungen letztlich
doch vor dem Kaiser militärisch-politisch zu rechtfertigen hatte; und
Graf Anton Günther versicherte sich allseits diplomatischen Schutzes,
auch und gerade durch den Kaiser, Tillys Herren. Trotzdem und entgegen
seiner überbetonen Rolle als „Pferdediplomat“ konnte der Graf später
nicht verhindern, dass 1627-31 doch noch kaiserliche Truppen in einigen
Orten der Grafschaft außer in der Stadt Oldenburg selbst zwangsweise
einquartiert wurden, was den Grafen viel Unterhalt kostete und die
Landbevölkerung erheblichen Unannehmlichkeiten aussetzte, ohne insgesamt
solch schlimme Züge anzunehmen wie in anderen Teilen des Deutschen
Reiches. Einigermaßen glimpflich davongekommen zu sein verdankt
Oldenburg allein diesem Grafen. Dies rechtfertigt in den Augen vieler
eine wenn auch späte Würdigung durch die heutige Bevölkerung.
Man kann ein
Denkmal dieses Grafen aber kaum mit der Begründung ablehnen, das
öffentliche Bild von ihm sei einseitig (wie von den meisten historischen
Gestalten), wenn man doch immer wieder die Möglichkeit hat, dieses Bild
erläuternd zu ergänzen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Menschen
zunächst immer aus ihrer Zeit heraus und dann auch als individuelle
Persönlichkeiten zu verstehen sind und nicht nach gegenwärtigen
Maßstäben gemessen werden dürfen. Anton Günther begriff sich eindeutig
nicht als „bürgernaher Herrscher“, was seine heutige Popularität in
Teilen der Bürgerschaft vielleicht vergessen lässt, sondern als adeliger
Landesherr von Gottes Gnaden, für den sein gesellschaftlicher Abstand
zum Bürger- und zum Bauernstand Bestandteil göttlicher Ordnung war. Das
Hauptaugenmerk seiner Herrschaftspolitik galt der Sicherung seiner
gräflichen Steuerbasis, seinem standesgemäßen Leben, das Wohl der Bevölkerung hatte er nicht primär
im Blick. Er setzte seine wirtschaftlichen Eigeninteressen daher über
die seiner Landeskinder und auch über die der Bremer Nachbarn, wie die
Durchsetzung des Weserzolls zu deren Lasten zeigt. Andererseits war er
kein rücksichtsloser Gewaltherrscher, was gerade in seiner Zeit nicht
selbstverständlich war, er kümmerte sich um die Ausstattung der
Landeskirche ebenso wie um die Linderung materieller Not bedürftiger
Untertanen. Der Graf war ein lebendiger Mensch mit Vorzügen und Fehlern.
(S. dazu Friedrich-Wilhelm Schaer, Art. Graf Anton
Günther, Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg,
Oldenburg 1992, S. 37-40.)
Das alles sollten die heutigen Oldenburger wissen, genauso wie sie zu
Recht nicht vergessen haben, dass der Graf in einer sehr kriegerischen
Epoche den Frieden für sein Land dauerhaft zu wahren wusste, schließlich
betrieb er aktive Neutralitätspolitik. Das zweifellos vor allem aus
wirtschaftlichem Eigennutz, doch die Bevölkerung profitierte weitgehend
von der Neutralität ihrer Grafschaft, in der die Lage längst nicht so
schlecht war wie in den vielen kriegszerstörten Gebieten Deutschlands.
Dass Anton Günther ein absoluter Regent zur Zeit der Monarchie war, kann
man ihm nicht vorwerfen, da er sich seine Lebenszeit und seinen
gesellschaftlichen Stand kaum selbst ausgesucht haben dürfte und
seinerzeit kein demokratisches Regierungsmodell als Alternative
existierte. Er hat auch, um es überzubetonen, kein Nazi-Parteibuch im
Keller und keine Parteispenden- oder Korruptionsaffäre am Hals gehabt.
Man kann ihm aber seinen permanenten und insgesamt erfolgreichen Einsatz
für Frieden im Lande und Schutz der Stadt Oldenburg zugute halten. Im Gegensatz
zu so manchen seiner und unserer Zeitgenossen ist er damit durchaus
denkmalwürdig.
Eine gute Möglichkeit, mit einem Anton Günther-Denkmal Geschichtswissen
der Bevölkerung aktiv zu gestalten und die Verkürzung auf populäre
Legenden einzudämmen, besteht darin, diesem eine Erklärungstafel
beizufügen; so wie es in Museen allgemein üblich ist, Ausstellungsstücke
mit wissenschaftlicher Beschreibung zu versehen. Darauf lässt sich
darstellen, dass der Graf ein absolutistischer Herrscher seiner Zeit
gewesen ist, vor allem eigenwirtschaftliche Interessen verfolgt und
seine Untertanen patriarchalisch kurz gehalten hat, ihnen aber auch mit
religiös fundierter Verantwortlichkeit begegnet ist und das Land
Oldenburg nach Kräften aus dem 30jährigen Krieg herausgehalten hat –
also keineswegs ein ausgesprochener „Bürgergraf“ war aber sicher mit
mehr Umsicht und Milde regiert hat als so mancher seiner Vorgänger und
Standesgenossen.
Kunstfragen
Das Bild des
Grafen in der Bevölkerung scheint geradezu eisern auf die Zeichnung
fixiert zu sein, in welcher er mit Grafenhut auf dem Kopf und Stab in
der Hand auf seinem barock-langbehaarten Lieblingspferd reitet, weshalb
ihn die Stiftergruppe wie selbstverständlich in ebendieser Pose wiederum
in Metall, in Bronze gießen ließ. Es wäre gestalterische Überlegungen
unter Geschichtsfachleuten wert gewesen, ob die bekannteste auch die
ideale Darstellungsform ist. Der Verfasser selbst hat lange vor Beginn
der aktuellen Diskussion ein Anton
Günther-Denkmal grundsätzlich befürwortet und dabei ebenfalls die
Form des zeitlosen Klassikers „Graf auf Kranich“ erwogen, weil sie der
Bevölkerung am eingängigsten ist und man nicht erst lang erklären
müsste, um wen es sich handelt, ehe man im Denkmalzusammenhang
Oldenburger Geschichte erläutern könnte.
Alternativ, so der Verfasser damals, ließe sich Anton Günther
prinzipiell „auch ‚zu Fuß’ in einem Denkmal darstellen, das der
geschichtlichen Bedeutung des Grafen für Stadt und Land Oldenburg
angemessen wäre“ – zumal Anton Günther zu Lebzeiten auch in dieser Weise
abgebildet wurde. Selbst wenn er in unser „Erinnerung“ immer nur reitet,
ist er doch gelegentlich zu Fuß gegangen, wie zeitgenössische
Darstellungen seiner Person in Herrscherpose und als Privatmann zeigen.
(Geschichte des Landes Oldenburg, 4. Auflage 1993,
Abbildungen S. 176, S. 178.)
Trotzdem wäre ein Reiterstandbild gerade diesem Grafen angemessener;
nicht nur, weil er Pferdezüchter und -liebhaber war, und nicht nur wegen
der Geschichte mit den Pferdegeschenken, die zwar übergewichtet aber
doch wahr sind. Sondern weil das Denkmal auf diese Weise wohl dem
historisch-originalen Lebensgefühl Graf Anton Günthers am nächsten
kommt, und seiner Zeit, in der sich ein Herrscher gerne offiziell zu
Pferde präsentierte. Diese Tiere waren über ihre Funktion als
alltägliches Last- und Verkehrsmittel hinaus bei entsprechendem Wert
zugleich Status- und Herrschaftssymbol (wie heute Autos). Wer darin
„Werbung für die Monarchie“ sieht, hat zwar die monarchische
Herrschaftssymbolik dekodiert, blendet aber die eigentliche Intention –
die geschichtsdarstellerische Funktion – eines solchen Denkmals aus, das
einen bemerkenswerten Aspekt der Vergangenheit wiedergeben, nicht aber
diese Vergangenheit in die politische Gegenwart übertragen will.
Insofern ginge auch die Annahme fehl, Reiterdenkmäler seien heute
generell nicht mehr zeitgemäß. Menschen unserer Zeit oder jüngster
Vergangenheit wird man in der Tat nur zu Pferde darstellen können, wenn
dies einen besonderen Bezug zu ihrem Leben oder ihrer speziell zu
ehrenden Leistung hat. Das trifft auch auf Anton Günther zu, doch bei
seinem Denkmal geht es eben nicht um die heutige Zeit sondern um ein
historisches Abbild einer vergangenen Epoche, um ein
Geschichtsdenkmal. Eine Geschichtsdarstellung in Form einer
historisch korrekt wiedergegebenen Persönlichkeit ohne beigefügte
wertende Symbolik wie Friedenstauben, Füllhörner (für Wohlstand),
Schriftzüge mit Vaterlandselogen und dergleichen wird schwerlich mit
altertümlich-untertäniger Fürstenhuldigung gleichzusetzen sein, zumal
wenn die Figur mit ausgewogenem Beitext kritisch begleitet wird.
Vielmehr könnte solch ein anschaulich realistisches Denkmal ein
didaktisch nutzbares Fenster in die Oldenburger Vergangenheit sein.
Damit würde man en passant sogar diejenigen erreichen, die ein Museum
nicht betreten und sich mit Geschichtsliteratur nicht beschäftigen
mögen. Möglicherweise könnte ein Anton Günther-Denkmal aber dazu
einladen, wenn sich 2017 der Todestag des Grafen zum 350ten Male jährt,
was vielen Oldenburgern Anlass sein wird, sich einmal näher mit der
Geschichte um den Grafen zu beschäftigen.
Das angebotene Grafen-Denkmal bekommt einen zusätzlichen geschichtlichen
Nebenaspekt durch den Umstand, dass es in Oldenburg – außer
Verwaltungs-, Garnisons- und Garten- auch Pferdestadt – zwar
Pferdeplastiken aber kein wirkliches Reiterdenkmal gibt. Obwohl es sich
aufgrund der geschichtlichen Bedeutung des Reitens anbieten würde, ist
in dieser Form bislang kein offizielles in der Stadt vorhanden.
Vielleicht weil der spezielle Anlass fehlte – geritten wurde schließlich
überall, den nun der Oldenburger „Pferdegraf“ bieten könnte, vielleicht
eher auch aus Kostengründen, die heute durch das Geschenk entfallen
würden, wurde das Thema nie aufgegriffen; nicht einmal beim Denkmal der
91er Dragoner, das einen Löwen zeigt. So könnte ein unmilitärisches
Anton Günther-Denkmal stellvertretend für alle anderen Reiter der
Oldenburger Vergangenheit stehen und auch auf die lebendige Gegenwart
des Reitsports und des Freizeitreitens hinweisen.
Ob das
Denkmal diese Funktionen erfüllen kann, wird sich möglicherweise nicht
zeigen, falls es gar nicht im öffentlichen Raum aufgestellt wird. Denn
Oldenburger Künstler und Kunstexperten lehnen das Geschenk ab, weil es
ohne künstlerischen Wert sei. Das ist nun ein Argument, das genauso
schwer zu wiederlegen wie zu belegen ist. Sicher gibt es objektive
Kriterien für den Wert von Kunst (wobei nicht der Geldwert gemeint ist),
vieles bleibt aber persönlicher Geschmack der Betrachter. Aufgrund der
deutschen Diktaturerfahrungen ist man im Falle solch apodiktischer
Begründung verbunden mit obrigkeitsähnlicher Durchsetzungsmacht rasch
beim Zensurvorwurf, der wie der Vorwurf des Unkünstlerischen beides sein
kann: gelegentlich überzogen, manchmal gerechtfertigt. Hinter einem „Un-Kunst“-Argument
kann sich allerdings auch verstecken, wer in einem falsch verstandenen
Reflex auf zwölf Jahre Nazizeit Denkmäler für ältere deutsche Geschichte
(wie diese selbst) generell ablehnt und dies nicht offiziell zugeben
mag. Solch ein einseitiges Geschichtsbild werden Kunstliebhaber und
Geschichtsbewusste sicher nicht vertreten wollen.
Dem Standbild wurde ebenfalls nachgesagt, es sei ohne eigenen Wert, weil
es sich „nur“ um Auftragskunst handele. Demnach wären dann sämtliche
durch historische Herrscher und wohlhabende Privatleute beauftragen
Kunstwerke keine solchen sondern lediglich profane Gebrauchsgegenstände.
Man gehe in Gedanken durch die berühmten Werke der älteren
Kunstgeschichte, die zu einem Großteil „nur“ in Auftrag der Geldgeber
entstanden sind, und überprüfe seine Beurteilung.
Der Dresdener Bildhauer Walter Hilpert, Erschaffer des Grafen-Denkmals,
hört gewiss „gerne“, dass hiesige Kollegen ihm ein adäquates
Kunstverständnis absprechen und seiner Statue damit die nötige
Schaffenshöhe. Man kann verstehen, dass stadtoldenburger Künstler hier gerne
zum Zuge gekommen wären und die Denkmalausführung nur ungern einem
Externen überlassen, der aber wenigstens von dem aus Hude und damit aus
dem Oldenburger Land stammenden Künstler Bernd Eylers vorgeschlagen
wurde und der Anschauung nach – die Statue des bekannten Oldenburger
Pferdes Donnerhall in der Langen Straße stammt von ihm – ein Meister der
naturalistischen Pferdedarstellung ist. Der reitende Graf erscheint auf
den Fotos ebenfalls realistisch wiedergegeben, so dass gar kein Zweifel
an der Professionalität des Bildhauers aufkommen sollte.
Mit der
grundsätzlichen Frage „Was ist Kunst?“ wurde, angestoßen durch die
Denkmalkritiker, das ganz große Fass aufgemacht, dass wir hier kurz mit
anstechen aber keinesfalls bis zur Neige leeren wollen.
Die eigentliche Frage lautet doch eher: „Wer definiert, was ‚Kunst’ ist“
– die Geisteswissenschaften allein, oder auch die Künstler selbst, und
hat die Bevölkerung mit durchschnittlich weniger abstraktem Geschmack,
die durch Steuern aber doch die meisten öffentlichen Kunstanschaffungen
bezahlt, dabei mitzureden? Dürfen umgekehrt heutzutage einzelne
wohlhabende und großzügige Mäzene ihren persönlichen Geschmack allen
Anderen vorschreiben? Muss man fragen, was schwerer wiegt: Klasse, Masse
oder Kasse – oder braucht man nicht vielmehr alle drei, um
gegenständliche Kunst in der Gesellschaft zu etablieren?
Der in der Bevölkerung ausgeprägte Wunsch nach „erkennbarer gefälliger
Gestalt“ von Kunstwerken kollidiert zuweilen mit dem gelehrten
Kunstverständnis offizieller Fachleute. Um künftige Misshelligkeiten zu
vermeiden, will die Stadt Oldenburg „Leitlinien für Kunst im
öffentlichen Raum“ ausarbeiten und deren Durchsetzung dann wohl streng
überwachen. Durch ein Gremium, das demokratisch durch freie, gleiche und
geheime Wahlen legitimiert ist? Dürfen sich nur Fachleute aus Kunst und
Kultur zur Wahl stellen, oder auch Vertreter der Mehrheitsbevölkerung,
und wie ist die Stimmgewichtung? Kann es so etwas wie Konsenskunst per
Abstimmung überhaupt geben, sofern sie sich nicht kulturell bedingt über
einen langen Zeitraum entwickelt hat?
Weil Experten (oft in bester Absicht) niemals wünschen, dass Laien ihre
fachlich gut begründeten Entscheidungen beeinflussen können, wird es
wohl weniger demokratisch zugehen, und das muss nicht schlecht sein. Es
ist bereits von anderer Seite richtig gesagt worden, dass echte Kunst
nicht per Mehrheitsentscheid definiert werden kann. Umgekehrt können
Fachleute unmöglich allein festlegen, was Kunst und Kultur insgesamt zu
sein hat, weil diese niemals allein die gegenwärtige Kultur gestalten
können – allenfalls rückblickend analysieren und bewerten, ohne dabei
die Freiheit heutiger Kunstausübung reglementieren zu wollen. Ohne das
Volk lässt sich keine Kulturnation machen, ohne einzelne herausragende
Künstler und Kulturspezialisten aller Sparten aber auch nicht.
Mehrheitsmeinung ist nicht automatisch die bessere, umgekehrt ist es
aber auch nicht zwingend, dass Expertenmeinung in jedem Fall richtiger
sei, wenn Fachleute bei ihrer Entscheidungsfindung allzu sehr auf ihr
eigenes Fach fokussiert wären und das Große Ganze bzw. fachfremde
Relevanzen aus dem Blick verlieren sollten. Im Idealfall ergänzen sich
schlicht beide Seiten. Der Verfasser ist für sich zu der Meinung
gekommen, dass kulturelle Vorgaben durch befähigte Spezialisten
zweckdienlich sind, solange diese Einwände von Laien immer als Chance
zur Überprüfung, als nötiges Korrektiv begreifen, denn niemand ist
perfekt.
Im Zuge der
öffentlichen Denkmaldiskussion ist ein Gegensatz zwischen
traditionell-gegenständlicher und modern-abstrakter Kunst aufgekommen,
der angesichts freier Entscheidungsmöglichkeit in einer (post)modernen
Kultur nicht zwingend ist. Vielmehr kommt es darauf an, was man
darstellen will, welche Werkaussage man erzielen will, schließlich
sollten Form und Inhalt einander bedingen.
Um der Gegenwart Raum zu geben, braucht eine Gesellschaft zweifellos
künstlerische Ausdrucksformen, in denen die aktuelle Zeitströmung leben
kann. Sie sind auch für bedeutungsgeladene Denkmäler angemessen,
besonders wenn diese zeitgenössische Sachverhalte darstellen. Es steht
jedem Künstler frei, dies auch für geschichtliche Inhalte oder Personen
zu versuchen. In Elsfleth, ausgerechnet in der den Grafen stets
kritischen Wesermarsch, steht seit 2008 ein 1,50 m hohes in moderner
Form gestaltetes Anton Günther-Reiterdenkmal quasi als Gegenentwurf zum
aktuell diskutierten Oldenburger Denkmal. Es wurde vom Oldenburger
Künstler Michael Ramsauer geschaffen und, als interessante Parallele zu
Oldenburg, vom Elsflether Mäzen Horst Werner Janssen privat gestiftet.
Ebenfalls in Bronze gegossen zeigt es Graf und Pferd fast ganz ohne
übliche Attribute, die Haare des Pferdes etwas kürzer, den Grafen
barhäuptig ohne jeglichen Gestand in der Hand, beide in weich
zerfließender Gestalt. Man sollte als Künstler einen Grund haben,
Geschichtliches so darzustellen, nach Interpretation des Verfassers zum
Beispiel, um die seitdem verflossene Zeit herauszustellen. Es aber nur
zu tun, weil man es unbedingt anders machen will als die Vorfahren,
hieße noch nicht, eine angemessene Formensprache gefunden zu haben. So
wie die traditionell gestaltete Reiterfigur eben wegen ihres
historischen Ausdrucks kritisiert wird, so kann die moderne gerade wegen
unhistorischer Symbolik kritisiert werden: Kein Graf wäre jemals ohne
das Herrschaftszeichen Grafenhut ausgeritten, und jeder Reiter hätte
zumindest eine Gerte dabei, wenn schon keinen modernen Schutzhelm.
Friedliche Koexistenz der Kunstrichtungen bedeutet „leben und leben
lassen“ für Anhänger beider Richtungen, der traditionellen und der
modernen. Demnach kann niemand billigerweise verlangen, dass Teile des
gestalterischen Schaffens nicht bewusst von moderner Formensprache
abweichen können, gerade wenn sie Themen behandeln, die nicht der
Gegenwart entspringen. Was spricht dagegen, ein Geschichtsdenkmal, das
„nachträglich“ an geschichtliche Ereignisse oder Personen erinnert, in
der ihm gemäßen Zeitsprache, also gegebenenfalls historisierend zu
gestalten, solange damit nicht über einen didaktischen Lehrzweck hinaus
die Denkungsweise vergangener Epochen wiederaufgelebt oder ein original
historisches Kunstwerk vorgetäuscht werden soll, sondern das Werk
lediglich der Veranschauung von Geschichte dient? Natürlich lässt sich
alte Geschichte auch in gegenwärtiger Formensprache gelungen darstellen,
sie kann aber leicht deplaziert wirken, wenn sie weniger auf den
geschichtlichen Kern zielte als vielmehr nur ein zweckfreies Spiel mit
modernen Möglichkeiten darstellte. Als sehr freies Beispiel dazu wäre
Graf Anton Günther auf einem Oldenburger Fahrrad eine gelungene
scherzhafte Anspielung auf unsere eigene Gegenwart, würde der
historischen Wirklichkeit seiner Zeit aber überhaupt nicht gerecht und
könnte deswegen nicht als Denkmal für Geschichte taugen.
Ab besten ist darum wohl die bereits praktizierte Mischung aus beidem,
im öffentlichen Raum je nach Anlass außer Modernem auch ältere Formen
zuzulassen und neben Abstraktem auch Gegenständliches aufzustellen. Ein
gelungener Kompromiss: Experten zeigen der in Kunstbelangen oft
traditioneller denkenden Bevölkerung neue Möglichkeiten, akzeptieren
aber die gleichzeitige Relevanz älterer Ausdrucksformen in der Gegenwart.
Entsprechend ließe sich das angebotene ganz im Stile des 17.
Jahrhunderts gestaltete Denkmal des Barockgrafen als bewusste
Historisierung begreifen und durchaus im öffentlichem Raum platzieren,
der in der Stadt Oldenburg arm an geschichtlichen Zeugnissen dieser Art
ist. Man will damit gar nicht erst den Eindruck eines avantgardistischen
Kunstwerkes machen, darf gleichzeitig aber auf keinen Fall den eines
alten historischen Denkmals erwecken, schließlich ist es nur ein
rückblickendes geschichtliches. Deshalb gehörte unbedingt das
Entstehungsdatum mit auf die Erläuterungstafel, damit auch bei
unbedarften Betrachtern nie ein Zweifel aufkommen könnte.
Trotz all
dieser bedenkenswerten Kunstbelange geht die öffentliche Diskussion
diesbezüglich teilweise am Thema vorbei. Sie ist auf manche falsche
Fährte geraten, die von der eigentlichen Kernfrage wegführt. Es geht den
Stiftern schließlich nicht um die Durchsetzung einer bestimmten
Kunstauffassung, sondern sie wollen schlicht ein Geschichtsdenkmal für
den Grafen Anton Günther aufstellen; und haben möglicherweise nicht
bedacht, in welche – aus ihrer Sicht – Irrwege sich die öffentliche
Debatte verlaufen kann.
Denn die hier noch weiter zu diskutierende Frage lautet nicht, ob das
angebotene Denkmalsgeschenk „Kunst“ sei, sondern ob das Denkmal den
Erinnerungsgegenstand, den historischen Oldenburger Grafen, angemessen
wiedergibt. Falls man sich einmal dazu durchringen kann, die Bevölkerung
per demokratischer Abstimmung entscheiden zu lassen, dann natürlich
nicht über Kunstfragen, sondern ob und wo ein Denkmal für Regional- und
Stadtgeschichte, die Erinnerung an einen trotz Einschränkungen im Sinne
der Bevölkerung verdienten Landesherren, im öffentlichen Raum
aufgestellt werden soll.

Das Wandgemälde des Grafen
am Hotel Graf Anton Günther in der Oldenburger Innenstadt. Foto: Martin
Teller, 6.1.2012.
Andere
Grafenzeugnisse
Kehren wir
zurück zum eigentlichen Thema und widmen uns einer grundsätzlichen
Überlegung. Ist ein Geschichtsdenkmal für den Grafen Anton Günther in
Oldenburg nicht entbehrlich, wo es doch schon viele Erinnerungen an ihn
in Stadt und Region gibt?
Für Menschen, die generell keinen Sinn für Geschichte haben, ist
jegliches Zeugnis davon überflüssig oder lästig, was manche betont
herausstellen, weshalb sie auch nichts mit einem Grafen-Denkmal
anzufangen wissen. Den Standardkommentar „zu teuer“ haben die Stifter
mit ihrem Geschenkangebot freilich unterlaufen. Die geschichtsbewussten
Teilnehmer der öffentlichen Diskussion können dagegen in der Tat leicht
eine Reihe von Stätten aufzählen, an denen Anton Günther in der
Hauptstadt seiner alten Grafschaft bereits verewigt wurde: das
Wandgemälde am Hotel „Graf Anton Günther“ in der Innenstadt, ein großes
Mosaik an der „Graf Anton Günther-Schule“, beide mit typischem Bild des
Grafen auf Kranich, im Schulnamen selbst, in einem Straßennamen, in
Vereins- und Firmennamen, natürlich auch in Dauerausstellungen des
Stadt- und des Landesmuseums, die Lebensaspekte bzw. teilweise die
originale Wohnumgebung des Grafen zeigen.
Bemerkenswert ist eine 2006 von dem Abiturienten Florian Müller
erstellte Figur, die vor der genannten Schule steht und ebenfalls den
reitenden Grafen Anton Günther in etwa lebensgroßer Proportion
darstellt. Sie besteht aus dem derzeitigen „Modematerial“ für
Außenkunstwerke: aus rostigem Eisen, und zeigt Ross und Reiter nicht als
Vollplastiken sondern geformt als ein hindurchsehbares Netz aus
Metallgestänge. Der gräfliche Kopf wird nur durch einen Hut
symbolisiert, der auf einer Metallstange steckt, die Rückgrad und Hals
darstellt. Der „Graf“ streckt in seiner rechten Hand einen Metallstab
vor. Das „Pferd“ hat eine bis zum Boden reichende Mähne und einen
ebensolchen Schweif, die beide aus Metallketten geformt sind. Trotz der
eher abstrakten Darstellungsweise erkennen Oldenburger anhand der
bekannten Attribute – Reiter, Hut, Stab, Pferd mit langer Mähe und
Schweif – sofort, um wen es sich handeln soll. Es ist wohl noch nie
vorher jemand auf die Idee gekommen, Graf Anton Günther auf solch
erfrischend unkonventionelle Weise zu zeigen. Noch in den 1950er Jahren
wäre die Skulptur ein Skandal gewesen. Sie erscheint als geradezu
professioneller Gegenentwurf zu traditionelleren Plastiken, zeigt mithin
bereits die moderne Bearbeitungsweise, die manche Künstler für
unerlässlich halten. Das Schüler-Denkmal zeugt von erfrischender
Unkonventionalität, von jugendlicher Unbefangenheit und
Geschichtsbewusstsein. Denn auch der Abiturient ist nahe am historischen
Thema geblieben und hat sogar nicht auf „Kranich“ verzichtet, eben weil
er wusste, dass eine entsprechende Formensprache sofort auf den
zugehörigen geschichtlichen Inhalt verweist. Das spricht bei Graf Anton
Günther für die Darstellung als Reiterstandbild.
Da haben wir doch schon ein Grafen-Denkmal in Oldenburg, und ein
originelles dazu? Nur bedingt. Zum einen widerspricht die hier gelungene
moderne Adaption des Themas nicht der obigen These, dass sehr moderne
Gestaltungsformen historischen Inhalten oft unangemessen sein können,
zumal wenn sich ein Denkmal seriös und nicht nur scherzweise mit einem
Geschichtsthema auseinandersetzen soll. Sie widerspricht auch nicht der
Forderung, dass es umgekehrt als künstlerisches Stilmittel möglich sein
muss, thematisch begründet ein Werk bewusst historisierend zu gestalten.
Außerdem ist das „Grafengerippe“ vielleicht gar nicht dauerhaft zu
betrachten (was bedauerlich wäre), da in Schulbesitz, und damit gar kein
eigenes Denkmal der Stadt. Die Schüler-Skulptur ist ebenso wie die
großen Grafenwandbilder genauer hinterfragt überhaupt kein Denkmal im
eigentlichen Sinne, denn diese Werke sind nicht bewusst zur Erinnerung
an Geschichte geschaffen, trotz historischer Anleihen illustrieren sie
eher vordergründig den Namen der Schule und des Hotels, als dass sie
Grafengeschichte und Landesgeschichte darstellen wollten. Dem pfiffigen Werk des
Abiturienten sei eine lange Existenz gegönnt, ein offizielles
Grafen-Denkmal in Oldenburg ersetzt es nicht, kann aber einen
interessanten Kontrapunkt dazu setzen.
Das gilt auch für die Museumsausstellungen, die einen anderen Charakter
haben als ein jederzeit zugängliches Freiluftdenkmal, das in einer Figur
(und einer Texttafel) ausdrücken muss, wozu Museen mitunter ganze Räume
und ein Kaleidoskop von Darstellungsmitteln haben. Die Verwendung des
gräflichen Namens auf vielerlei Weise spricht auch nicht gegen ein
dreidimensionales Anton Günther-Denkmal, das es im Oldenburger Stadtbild
noch nicht gibt. In der alten Hauptstadt, dem zentralen Erinnerungsort für Landesgeschichte, ist es
aufgrund seiner sowohl stadt- als auch landesgeschichtlichen Aussage
passend platziert, unabhängig von allen weiteren Zeugnissen des Grafen
im Oldenburger Land. In Form der angebotenen Skulptur wäre das Denkmal
ein „Gemälde zum Anfassen“ aus dauerhaftem Material, das wie oben
erwähnt geschichtsdidaktisch nutzbar wäre als gleichsam in den
öffentlichen Raum installierte Geschichtsfigur, und überdies touristisch
als sicher beliebtes Fotomotiv.
Fast ein
Jahrhundert nach Ende der Monarchie und nach bisher 67 Jahren
ununterbrochener Demokratie sollte man keine Berührungsängste mit
Herrschergestalten der monarchischen Epoche haben. Oldenburg ist über so
lange Zeit seiner Geschichte hinweg mit dem Grafen- und Herzogshaus
verbunden gewesen, dass man einzelne – besonders herausragende verdiente
– Mitglieder dieser Familie in Denkmälern ehren können sollte, und wenn
einer der früheren Herrscher außer dem bereits bedachten Herzog Peter
Friedrich Ludwig denkmalwürdig ist, dann Graf Anton Günther. Ohnehin
geschehen Denkmalsetzungen in dieser Stadt zum Glück nicht einseitig.
Sie hat schon etliche denkmalwürdige bürgerliche Demokraten geehrt, wie
den Journalisten und Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky, ein
kritischer Kopf, der mit demselben am Theaterwall ausgestellt ist, sowie
als sitzende Brustfigur am alten Rathaus den trotz unvorteilhafter
Brille weitblickenden Oberbürgermeister Theodor Görlitz. All dies trägt
zur vom Verfasser so genannten geschichtsindividuellen Gestaltung der
Stadt bei, welche unsere gegenwärtige Lebenswelt um die zeitliche
Dimension ergänzt.

Das unverkennbare
Reiterstandbild vor der Graf Anton Günther-Schule in Oldenburg. Foto:
Martin Teller, 6.1.2012.
Ein
historisches Detail
Wer
Geschichtssinn hat, wird sich den Elementen des Vergangen nie unkritisch
stellen. Nachdem die seit März 2010 konzipierte Denkmalfigur
fertiggestellt und im Sommer 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde,
haben sich Oldenburger Geschichts- und Kunstexperten öffentlich oder
privat damit auseinandergesetzt. Es heißt zwar: „Einem geschenkten Gaul
schaut man nicht ins Maul“. In diesem Fall muss man aber vorher genau
auf das angebotene Reiterdenkmal schauen, handelt es sich doch um ein
Objekt für den öffentlichen Raum, das eben zum Betrachten geschaffen
wurde.
Als Milde für die Stiftergruppe das Standbild der Stadt zum Geschenk
anbot, sagten Fachleute, sie hätten sich eine Beteiligung der
Öffentlichkeit gewünscht, was sie sonst nur selten tun, weshalb man
davon ausgehen kann, dass die Experten vor Fertigstellung des Denkmals
selbst gerne gehört worden wären. Dies allerdings wäre trotz Mildes
schlechten Erfahrungen so verkehrt nicht gewesen, wenn man dabei
qualifizierte fachliche Unterstützung hätte bekommen können. Oben kam
schon zur Sprache, dass zwar an der professionellen Art der
Denkmalausführung kein Zweifel bestehen kann. Auch die Kleidung und
weitgehend die Ausrüstung des Grafen und die Ausstattung des Pferdes
entsprechen soweit ersichtlich der historischen Vorlage. Manchen gefällt
die historisierende Ausführung des Denkmals nicht, aber das müsste kein
grundlegendes Hindernis bleiben.
Doch Dr. Michael Reinbold, Leiter der Abteilung Kunstgewerbe des
Landesmuseums im Schloss, hat in einem Zeitungsleserbrief
(Nordwest-Zeitung, 2.8.2011, Nr. 178) öffentlich darauf
hingewiesen, dass in einem figürlichen Detail ein nicht irrelevantes
Missverständnis steckt: „Auf dem Urbild von 1667 hält der Graf in seiner
ausgestreckten Rechten einen Kommandostab im Segensgestus über sein
Oldenburger Land.“ – und nicht wie im angebotenen Standbild eine bloße
Reitgerte neben den Pferdekopf. Dieses Detail macht den Unterschied aus
zwischen der gemeinten historischen Grafenfigur und einer ungewollt
willkürlichen Anton Günther-Darstellung, zwischen einer durchdachten
landesherrlichen Haltung und einer ungewöhnlichen reiterlichen
Gertenhandhabung, was nicht im Sinne der engagierten Stifter selbst sein
kann.
Die irrtümliche Verwechselung des starren, mehr als fingerdicken
historischen Kommandostabes mit einer damals wie heute gebräuchlichen
dünnen und biegsamen Gerte dürfte wesentlich zur generellen Ablehnung
des Denkmals durch manche Fachleute beigetragen haben:
Geschichtsexperten müssen ohnehin gegen ein simplifizierendes Bild Anton
Günthers anarbeiten, und nun auch noch gegen ein falsches Bildzitat? Auf
einem Pressefoto im Zeitungsartikel zur Vorstellung des Denkmalprojektes
ist die Entwurfzeichnung zu sehen, die vielleicht noch den richtigen
Kommandostab enthält, einen allerdings schon recht dünnen langen Stab
mit Knaufabschluss (Nordwest-Zeitung, 2.3.2010, Nr. 52).
Es gibt aufwendig gefertigte Gerten, die ebenfalls einen Knauf am Ende
haben, was die Verwechselung erklären dürfte, nicht aber die Umformung
zu einem abgewinkelten reinen Gertengriff in der fertigen Skulptur. Bei
gewünschter originalgetreuer Wiedergabe einer historischen Figur müsste
die künstlerische Freiheit enden.
Viele denkmalbefürwortende Geschichtsfreunde würden sich sicher nicht an
dem scheinbar nur kleinen Fehler stören, wie etliche unter ihnen auch
die gräflichen Pferdegeschenke immer wieder übergewichten. Der Verfasser
kennt aber seine Historikerzunft, die mit wissenschaftlicher Strenge
noch nach Generationen den (Kommando)Stab über jene brechen würde, die
Graf Anton Günther ein Denkmal errichtet hätten, das missverstandene
politische Ikonographie enthielte, das dadurch die historische
Bildaussage in einem wesentlichen Punkt verfälschte und damit der
vereinfachten volkstümlichen Sagengestalt des Grafen näher wäre als der
eigentlich gewollten Geschichtsperson. An der berechtigten Forderung
nach wissenschaftlicher Genauigkeit und Wahrheit kommt man als Fachmann
nicht vorbei, selbst wenn man prinzipiell ein Anton Günther-Denkmal
befürwortet und auch gegen eine Historisierung nichts einzuwenden hätte.
Gäbe es das
Detail mit dem unkorrekt interpretierten Kommandostab nicht, wäre die
Zahl der Kritiker vermutlich kleiner, von denen sich anscheinend etliche
an der vorgestreckten Gerte stören, die ihnen wohl nicht wie eine
harmlose Zeigegeste vorkommt sondern sie in unhistorischer Verknüpfung
an die arrogante Haltung von Herrenmenschen einer ganz anderen
Geschichtsperiode erinnert. Dann hätte auch kein Denkmalkritiker dem zäh
für das Denkmal eintretenden Milde „versuchte politische
Richtungsvorgabe per Reitpeitsche“ vorwerfen können. Denn die Reitgerte,
wie sie im Reitsport richtigerweise genannt wird, ist eine
Fehlinterpretation auch der Kritiker: Sie sollte in Wirklichkeit eben
der symbolhaft segnende Kommandostab des frühneuzeitlichen Landesherren
sein. Das Einzige, was man dem früheren Verwaltungspräsidenten des
Oldenburger Landes „unterstellen“ könnte, wäre eine Politik mit
Marschallstab, Zögerlichen und Kleinmütigen die Richtung weisend. Aber
dazu ist dieser Demokrat zu erfahren, zu wissen, dass man niemandem Sinn
für Oldenburger Belange oder Mut zum Gestalten befehlen kann. Man kann
nur hoffen, dass diejenigen, die entscheiden dürfen, beides auch haben.
Die
ungeplante Gerte ist ein guter Anlass, noch einmal über alternative
Darstellungsformen eines Reiterdenkmals für den Grafen nachzudenken, der
nicht permanent als spätere „Oldenburger Geschichtsikone“ mit einem
unhandlichen Kommandostab umhergeritten ist, und der auch andere Pferde
geritten hat außer Kranich, dessen barocke Haarverlängerung nur wenig
alltagstauglich gewesen sein dürfte. Viel eher wird der Graf wie in der
reiterlichen Praxis üblich beim Ausreiten eine Gerte dabeigehabt haben,
sicher eine besonders aufwendig gefertigte, um falls nötig damit
gegenüber dem Pferd seine Körperhilfen zu verstärken; modern für
Nichtreiter: bei seinem „Fahrzeug die Gänge zu schalten“, wozu übrigens
auch Sporen dienen. Man hätte mit den Formen bewusst spielen können,
dann wäre es beispielsweise möglich gewesen, Graf Anton Günther als
normalen Reiter darzustellen, mit seitlich angelegter Gerte wie beim
Reiten üblich. Denn eine Gerte hält man, wie man als Reiter weiß,
normalerweise nicht neben den Pferdekopf, um das Tier nicht nervös zu
machen, außer wenn man vielleicht im Hochsommer Pferdebremsen
verscheucht. Solch eine ungezwungene Reiterdarstellung des Grafen wäre
durchaus neu gewesen und doch nicht unhistorisch. Wenn das Denkmal wegen
der zu erwartenden höheren Akzeptanz aber eine dreidimensionale
Umsetzung der bekannten Gemälde sein soll, ist ein Kommandostab wegen
historischer Korrektheit unerlässlich, und nicht nur wegen des erwähnten
praktischen Wiedererkennungswertes des Grafen.
Denkmalnutzung
Wie der
Verfasser könnten auch andere anfangs nicht Eingebundene überlegen, ob
das unerwartet angebotene Denkmal nicht doch zur Darstellung der
Regionalgeschichte nutzbar gemacht werden kann. Man könnte die fremde
Denkmalinitiative als Möglichkeit begreifen, den Prozess im Sinne der
Kulturwissenschaften konstruktiv-korrektiv zu begleiten. Ein Denkmal
dient schließlich dem erstrebenswerten Zweck des Nachdenkens, das nicht
bei den Verdiensten des Grafen enden müsste, sondern bei den Betrachtern
auch sein gesamtes persönliches Handeln und seine Zeitumstände kritisch
hinterfragen lassen könnte, womit der Bildungszweck erreicht wäre.
Ein
wesentlicher Störfaktor ist die Gerte, ein Interpretationsfehler, der aber nicht generell gegen die
Errichtung eines Anton Günther-Reiterdenkmals in Oldenburg spricht, und auch nicht
endgültig gegen die Nutzung des zur Debatte stehenden, weil sich hier
vielleicht noch etwas ändern lässt. Zusammengefasst sind manche Einwände
gegen das Standbild bei näherem Hinsehen haltlos, einige durchaus
berechtigt, wobei man den Stiftern – die immerhin
Gestaltungsvorstellungen haben – nicht ihren engagierten Bürgersinn
absprechen kann; und einen gewissen Oldenburger Regionalpatriotismus,
der in seiner Unmodernität vielleicht gerade ein Zeichen unserer
wandlungsreichen Zeit ist: als Wunsch nach einem verlässlichem
Lebensrahmen. Dieser hat seine Berechtigung, indem er Einigen
Orientierungsmöglichkeiten in einer unübersichtlichen Welt gibt, Anderen
nötigen Rückhalt, sich den Chancen zu widmen, die fließender Wandel
immer auch bietet.
Gemäß ersten
Politikervorschlägen verlangen die geplanten Leitlinien für öffentliche
Kunst in Oldenburg von dieser „hohe künstlerische Qualität, innovative
Konzepte und gesellschaftliche Relevanz“. Was das Anton Günther-Denkmal
betrifft, ist die qualitative Ausführung durch den erfahrenen Bildhauer
Hilpert offensichtlich gegeben. Dass Geschichte und alles, was über sie
aufklärt, gesellschaftlich relevant ist, dürfte auch außer Frage stehen.
Denn nicht nur unsere augenblickliche Existenz in der absoluten
Gegenwart ist für uns von Belang, sondern auch unser Dasein in der Zeit,
das uns temporäre Wesen gleichzeitig Teil von planender Zukunft und
auszudeutender Vergangenheit sein lässt. Innovativ ist das angebotene
Bildnis ganz sicher, wenn man nur an die unkonventionelle Gertenhaltung
denkt, aber auch an den Mut, ein historisierendes Werk zu schaffen, dass
nach konventioneller Meinung von Experten heute nicht der
Mehrheitsrichtung der Kunstschaffenden entspricht. Natürlich hätte man
auch andere Darstellungsweisen des Landesgrafen erwägen können, dennoch
ist eine „Dreidimensional-Werdung“ eines bekannten Gemäldes ein
originelles Konzept, das im öffentlichen Raum „funktionieren“ dürfte.
Bei der Umsetzung einer innovativen Einbettung des Grafen-Denkmals in
die Stadtlandschaft könnten sich viele Menschen hervortun – Stichworte:
genaue Standortsuche und Umfeldgestaltung nebst Tafeltext – und der
scheinbaren Sagengestalt endlich ein wirkliches Geschichtsdenkmal
widmen. Sicherlich ist es möglich, sich dafür unter Kulturexperten und
Geschichtsinteressierten mehrheitlich über die folgenden Punkte einig zu
werden, wenn nicht sofort dann vielleicht noch im Laufe des
gegenwärtigen Jahrhunderts:
Die geschichtliche Rolle Graf Anton Günthers hängt nicht von
vereinfachenden Sagen über ihn ab. Die Neutralitätspolitik des Grafen im
30jährigen Krieg hat viele Oldenburger vor schweren Kriegsfolgen
bewahrt. Zur Erinnerung daran kann an einem passenden Ort ein
zur Reflexion einladendes Geschichtsdenkmal aufgestellt werden, dessen Form den geschichtlichen
Inhalt bzw. die Geschichtsperson adäquat wiedergeben muss. Mit diesem
Akt der regionalgeschichtlichen Selbstbestimmung soll weder die
Monarchie wiedereingeführt werden noch eine Kunstrichtung als die
Alleingültige erklärt werden. Niemand, der sich zur Sache höflich und
konstruktiv äußert, wird wegen seiner Auffassung herabgesetzt. Anhand
der Vorschläge von Kulturfachleuten entscheiden die Oldenburger Bürger
mit, welche Denkmäler in ihrer Stadt aufgestellt werden. Die Politik
akzeptiert Einigungen der beiden Gruppen und setzt bürgerlichen
Mehrheitswillen um, wenn dieser gesetzeskonform ist und auf den
Grundsätzen von Ethik und praktischer Vernunft beruht.
Wenn der
Verfasser freilich bis zur allgemeinen Übereinkunft allein entscheiden
könnte, würde er die Sache mit einer pragmatischen Lösung abkürzen. Wie
bereits dargelegt geht es für Geschichtsfachleute, die einen ideellen
oder reellen öffentlichen Bildungsauftrag haben, in der ganzen
Denkmaldiskussion vorrangig darum, ob Darstellung und Darstellungsweise
einer geschichtlichen Figur auf dem Hintergrund historischer
Erkenntnisse vertretbar sind. Die historische Rolle Anton Günthers und
seine generelle Denkmalwürdigkeit können unter Fachleuten graduell
verschieden beurteilt werden, ebenso der zu verwendende Kunststil.
Einigkeit dürfte aber darin bestehen, dass ein historisches Bildzitat
korrekt sein muss und der Kommandostab in der Hand des Grafen eben keine
unüblich gehaltene Reitgerte ist.
Zur Abhilfe sind zwei Lösungsansätze erkennbar. Der simple wäre, die
Gerte offiziell als künstlerische Variation eines Kommandostabes
umzudeuten. So etwas funktioniert aber eher in der Politik als in der
Wissenschaft, und da Oldenburg auch eine Wissenschaftsstadt ist mit
vielen Experten, die viel von ihren Fächern verstehen und das fachlich
geschulte Denken nicht aus Opportunität einstellen, bietet sich eine
zweite nachhaltigere Lösung an: Ungetrübt jeder Materialkenntnis erlaubt
sich der Verfasser den pragmatischen und vielleicht wenig
künstlersensiblen Vorschlag, die Grafenfigur punktuell so
nachzubearbeiten, dass ein wirklicher Kommandostab deutlich erkennbar
wird, wie er anfangs – siehe Entwurfsskizze – auch wohl geplant war.
Dieser Vorschlag, der einem erfahrenen Künstler handwerklich zuzutrauen
ist, versteht sich überhaupt nicht als dirigistischer Eingriff in die
Kunstausübung, da es hier gar nicht um eine frei erdachte Skulptur geht,
sondern um die vorlagengetreue Wiedergabe einer geschichtlichen
Abbildung. Ob nun der Stab etwas verdickt würde, vielleicht durch
Überzug einer Bronzeumhüllung, oder zumindest der Hakengriff zum Knauf
umgearbeitet würde, damit die Gerte problemlos als Kommandostab
durchgehen kann, wäre Sache des Künstlers. Sollte das Bildnis partiell
oder ganz umgegossen werden müssen, was anscheinend bis zu einem Jahr
dauern kann und im Falle höherer Kosten das Engagement sämtlicher
Denkmalbefürworter unter Beweis stellen könnte, dann wäre das nicht
schlimm, denn bis zum nächsten geschichtlichen Bezugstermin, dem Anton
Günther-Jubiläumsjahr 2017, wären die Arbeiten längst abgeschlossen.
Mit dieser möglichst einfach zu haltenden Änderung entfiele der fachliche
Hauptkritikpunkt an der Skulptur, was die entscheidenden Kunstexperten
über den historisierenden Stil hinwegsehen und grünes Licht zur
Aufstellung des Denkmals geben lassen könnte. Ein solcher Kompromiss
sollte ganz im Sinne des Staatsmannes Milde sein, da das Denkmal doch
noch realisiert würde, und auch dem Bildhauer sollte es nicht schwer
fallen, da er doch kein Experte für historische Oldenburg-Kunst ist und
nicht wissen konnte, wie gravierend sich der Unterschied zwischen einem
Knauf und einem Hakengriff für die Akzeptanz seines Werkes auswirken
kann.
Die
Standortfrage
Wenn sich
alle Beteiligten einander entgegenkommen und sich soweit einigen
könnten, wäre auch der zweite Hauptstreitpunkt dieser Debatte, die Suche
nach einem geeigneten Standort für das Graf Anton Günther-Denkmal, wohl
schnell abzuarbeiten. Idealerweise läge er innerhalb Oldenburgs als
alter Landeshauptstadt, dort dann an einem historischen Ort mit Bezug
zur Grafengeschichte. Das wäre, wenn man den Stadtkern betrachtet, am
ehesten im ehemals herrschaftlichen Südteil zwischen Lambertikirche und
Schloss, nicht im nördlich gelegenen bürgerlichen Teil. Der von vielen
Seiten gemachte Vorschlag, das Denkmal solle beim Oldenburger Schloss
aufgestellt werden, ist sehr naheliegend, wurde die einstige
Grafenresidenz doch ausgerechnet unter Anton Günther zum Barockschloss
ausgebaut, dessen Bestandteile noch die heutige Baugestalt maßgeblich
bestimmen. Dabei ist es zweitrangig, ob der genaue Standort nun vor,
neben oder hinter dem Schloss läge, etwa auf dem Schlossplatz als
direktes Pendant zum Denkmal Peter Friedrich Ludwigs, das auch von einem
wohlhabenden Privatmann gestiftet wurde, oder auf dem Rasenstreifen
nördlich neben dem Schloss, wo besonders darauf zu achten wäre, dass das
Standbild nicht den willkürlichen Eindruck einer bloßen Gartenzierfigur
machte, oder auch im Pflaster zum
ECE-Einkaufszentrum, dem laut Neonbeschriftung sogenannten „Schloss
Höfe“.
Hier würde das Grafen-Denkmal erheblich besser passen als die drei
Bronzebären, welche die Stadt wieder aufgestellt hat, nachdem der Platz
umgestaltet und von Berliner Platz ins historisch richtige Schlossplatz
umbenannt wurde. Seitdem sind die früheren
„Berliner Bären“ dort zu einem
Fremdkörper geworden und würden besser auf den neuen Berliner Platz im
Norden des Hauptbahnhofs umziehen, denn sie sind nicht explizit für den
Standort am Schloss geschaffen worden sondern zur Illustration (irgend)eines
Berliner Platzes wo auch immer. Durch Wiederaufstellung auf dem
nunmehrigen Schlossplatz hat man die drei Bären aus ihrem
Sinnzusammenhang gerissen und von einem Staatsdenkmal zu bloßen
Tierfiguren degradiert. Die geplanten Richtlinien öffentlicher Kunst
beinhalten hoffentlich auch den Aspekt Standortrelevanz.
Ein anderer möglicher Ort für das Anton Günther-Denkmal wäre die
Grünfläche südlich des Schlossgebäuderinges, etwa anstelle der
„Liegenden“, die ohnehin besser auf die große Liegewiese in den
Schlossgarten passt, wo dieses moderne Kunstwerk mehr Sinn und Beachtung
fände. Der Reitergraf könnte hier nach Süden ausgerichtet werden, mit
Blick auf den Damm, Teil der wichtigsten historischen Fernstraße
Oldenburgs, über die Anton Günther oft mit seinem Gefolge in Richtung
seiner Jagdreviere bei Hatten, Hude und Dingstede geritten ist. Bei
konsequenter gleichwohl historisch verkürzender Betrachtung Anton
Günthers als „Friedensfürst“ könnte man zwar eine Aufstellung des
Standbildes auf dem Friedensplatz neben der Friedenssäule erwägen, doch
jener Ort hat keinen geschichtlichen Bezug zu dem Grafen. Der wäre
eventuell noch innerhalb des „herrschaftlichen“ Wallringes gegeben, der
schon zu Anton Günthers Zeiten die später noch ausgebauten
Befestigungsanlagen der Stadt enthielt, nicht aber im heutigen
Schlossgarten, den es zu seiner Zeit noch gar nicht gab, wo eher das
Denkmal des Parkgründers Peter Friedrich Ludwig einen sinnvollen Platz
hätte. Als ebenfalls denkbare Lösung bietet sich für Geschichtsbewusste
der Bereich zwischen Dobbenstraße und Eversten Holz an, praktischerweise
wohl am Rande des Holzes zur Meinardusstraße. Denn am alten Eversten
Holz hatte sich Graf Anton Günther einen herrschaftlichen Ziergarten
anlagen lassen, ein Pendant zum Wunderburgpark seiner Gemahlin in
Osternburg. An diesen sogenannten Herrengarten, der längst mit
Wohngebäuden überbaut ist, könnte das gräfliche Reiterdenkmal erinnern.
Angesichts der vielen passenden Standorte müsste man wünschen, dass
Oldenburg noch mehr regional- oder stadtgeschichtliche Denkmäler
angeboten bekommt. Wenigstens sollte man sich künftig gründliche
Gedanken über geeignete Standorte von Kunstwerken und Denkmälern im
öffentlichen Raum machen, denn manche der vorhandenen würden an anderen
Orten ihren Sinngehalt viel besser zur Wirkung kommen lassen.
Der von
Milde vertretenen Stiftergruppe ist zu wünschen, dass sie mit ihrer
unkonventionellen Denkmalinitiative ebenfalls die von ihr beabsichtigte
Wirkung erzielt: den Oldenburger Bürgern eine Freude zu machen. Sollte
das Denkmal gleichzeitig dauerhaft zur regionalgeschichtlichen Bildung
beitragen, könnten sich auch die Kulturfachleute freuen. Natürlich muss
akzeptiert werden, wenn nicht Alle mit dem Grafen-Denkmal oder seiner
Stilrichtung etwas anfangen können. Man kann aber dessen Intention, an
eine Friedensleistung zu erinnern, auf die Debattierenden übertragen und
an diese appellieren, einen akzeptablen Konsens zu finden, der den Bezug
auf relevante ältere Oldenburger Geschichte in einem Denkmal ermöglicht.
Mildes intensivem Werben für das Denkmalprojekt verdanken etliche
Oldenburger derzeit einen genaueren Blick auf die unbekannten Seiten
ihrer bekanntesten Geschichtsperson, sowie ein schärferes Bewusstsein
für kommunale Gestaltungsprozesse. Mindestens dafür könnten ihm die
Menschen in Stadt und Land tatsächlich danken.
* * *
Zusätzlich
zu einem Grafen-Denkmal im frühneuzeitlichen Stile kann sich der
Verfasser durchaus auch eine vorsichtige modernere Darstellung des
Themas Landesgeschichte vorstellen, die dennoch stilistisch ihren
geschichtlichen Inhalten gerecht würde und gleichzeitig in unserer
Gegenwart verankert wäre. Der Schlossplatz eignet sich bestens als
Erinnerungsort für die Geschichte des ganzen historischen Oldenburger
Landes, in dem nicht überall aber doch vielerorts noch ein
Zusammengehörigkeitsgefühl besteht. Dies könnte dort symbolisiert werden
durch einen „Oldenburger Landesbrunnen“, als Einzelstück weniger
wartungsintensiv als die früheren vielen modernen Brunnen, anders als
diese randlich gelegen und somit keinen Veranstaltungen im Weg.
Der Landesbrunnen wäre bestückt mit ganz verschiedenen plastischen
Oldenburg-Motiven in hochwertiger und haltbarer Bronze, wobei sich
Geschichte und Symbolik ergänzen könnten: zum Beispiel u.a. ein
Landeswappen, Graf Anton Günther en miniature mit oder ohne Ross,
wichtige noch stehende und abgerissene Gebäude der Stadt wie alle drei
Rathäuser und die Wassermühlen (eventuell mit beweglichem Rad),
Hunte-Symbolik, Figuren alter Berufe, stilisierte Darstellungen der
Oldenburger Land- und Ortschaften usw., vielleicht gekrönt von einer
Grünkohlpalme – als Zeugnis von Geschichtsverständnis, das den Wunsch
von „Erdung“ durch Heimatgefühl ernst nimmt und zugleich mit einer
gelassenen Leichtigkeit über sich selbst lächeln kann.
|
Martin Teller, 16.2.2012 |
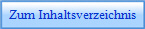 |
|