|
Historische Wohntradition im Schlossgarten
●
Unter den Eichen von Gut Drielake
●
Alte Gärten, neue Höfe
Historische Wohntradition im Schlossgarten
Zum Heidenwall (siehe
Reflexionen 5) zeitgleich ein
weiterer Heidenschreck: Die Leser der örtlichen Presse erfuhren dieser
Tage voller Verwunderung, die erst letztes Jahr eingestellte Leiterin
des Schlossgartens, Frau Trixi Stalling, sei entlassen worden. (Zeitungsberichte
seit 10.2.2007, hier v.a. NWZ vom 13.2.: „Gartenchefin wegen Wohnungsstreit
gefeuert“).
Die
Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß, denn Frau Stalling hatte sich
bereits durch ihr kreatives Engagement einen Namen gemacht. Ihr
verdanken es viele Oldenburger, darunter der Verfasser, am Tag des
offenen Denkmals im September 2006 erstmals den von einer hohen
Backsteinmauer umgebenen Küchengarten betreten haben zu dürfen, der als
herrschaftlicher Nutzgarten bzw. als moderner Aufzuchtgarten bis dahin
für den Publikumsverkehr gesperrt war. Dieser historische Ort mitten im
Oldenburger Schlossgarten – derzeit hauptsächlich eine weite
Streuobstwiese – soll zukünftig permanent zugänglich sein, was eine
wesentliche Bereicherung der Parkanlage darstellt.

Der Küchengarten im Schlossgarten zu Oldenburg, mittlerer
Teil, Blick nach Nordwesten. Im Hintergrund die ca. 4 m hohe
Backstein-Ringmauer. Foto: Martin Teller, 10.9.2006 (FA-XXXI25).
Anlass der
Kündigung durch ihren Vorgesetzten, den Leiter des Landesmuseums für
Kunst und Kulturgeschichte (im Oldenburger Schloss) Prof. Dr. Bernd Küster,
war offenbar ein Streit um die Frage, ob die Gartenleiterin im
sanierungsbedürftigen Hofgärtnerhaus zu wohnen habe. Sie sollte ins
Obergeschoss unter dem Dach ziehen, dessen zumeist schräge Wände nur
kleine Fenster und keinen Balkon haben, während der Hauptteil des
Hochparterres inklusive größtem Raum und Gartenterrasse für
Ausstellungen und Veranstaltungen vorgesehen ist.
Prinzipiell
ist es zu begrüßen, dass der Schlossgarten einem (Kunst)Historiker untersteht,
wird damit doch die geschichtsträchtige Besonderheit des Ortes
unterstrichen, was nicht der Fall wäre, wenn dieser wie eine ganz
normale Grünfläche verwaltet würde. Aber auch als Fachmann für
Vergangenes wird man den Bedingungen und speziell den Wohnbedürfnissen
des gegenwärtigen Lebens verständnisvoll gegenüberstehen. Angestellte
sind nun einmal keine leblosen Ausstellungsgegenstände, die man beliebig
umsortieren kann. Wie alle Gartenpflanzen so braucht auch deren oberste
Pflegerin Licht und Raum zum Gedeihen. Ob es zumutbar ist, 30 Jahre –
ein ganzes Berufsleben lang und womöglich mit Familie – im Dachgeschoss
eines Hauses aus dem frühen 19. Jahrhundert zu leben (1808-11 erbaut,
solche Wohnsituationen nannte man in früheren Zeiten
„Dienstbotenzimmer“), ist im thematischen Zusammenhang dieser
Netzpräsenz allerdings nicht näher zu diskutieren.
Weiterhin
ist positiv zu vermerken, dass das ganze Haus bis 2008 zum 200jährigen
Bestehen des Schlossgartens gründlich saniert sein soll, was bei aller
Rücksichtnahme auf die historische Bausubstanz sicherlich eine sensible
Verwendung modernster Materialen und technischer Einrichtungen
einschließt, möglicherweise auch größere Dachschrägenfenster. Dabei
steht außer Frage, dass danach das Dachgeschoss in dem kleinen Haus in
irgendeiner Weise mitgenutzt werden muss. Jeder, der mit historischen
wie modernen Immobilien einigermaßen vertraut ist, weiß, wie schnell
nicht genutzte, besonders nicht geheizte Räume verfallen.

Die zum Küchengarten gelegene Südostseite des
historischen Hofgärtnerhauses im Schlossgarten zu Oldenburg. Foto:
Nordwest-Zeitung, Freitag, 16.2.2007, Nr. 40.
Auch die
Gretchenfrage der Residenzpflicht kann eigentlich nur befürwortet
werden. Sicher wäre es sehr zweckmäßig, wenn die „Hofgärtnerin“ hier
wohnen würde, um bei Bedarf auch nachts oder am Wochenende vor Ort zu
sein (was nicht heißen würde, permanent an Haus und Hofgarten gebunden
zu sein). Es mag zudem unseren romantischen Vorstellungen entsprechen,
unserer Sehnsucht nach geordneten Verhältnissen, zwischen Gärtnerin und
Garten eine räumliche wie ideelle Einheit herstellen zu wollen – in
einer Welt, die alles andere als wohlgeordnet und übersichtlich
erscheint. Aus historischer Sicht, d.h. genauer aus Sicht des
Historikers, hätte die Sache aber den besonderen Reiz der „gelebten
Geschichte“, was nicht mit zweckfreiem (oder allenfalls lehrreichem)
„Geschichte nachspielen“ zu verwechseln ist. Vielmehr wäre eine im
Garten wohnende und arbeitende „Hofgärtnerin“ die Fortsetzung einer
sinnvollen historischen Tradition, nur unter modernen Vorzeichen und mit
modernen Mitteln, und eben mit einer zu modernisierenden Wohnung.
Dieses
gewollte Lebendighalten von Historischem, das ein Historiker gewöhnlich
nicht verurteilen wird, enthält in diesem Fall aber einen grundlegenden
Fehler: den der Inkonsequenz. Nicht nur der unmittelbare Vorgänger von
Frau Stalling, Karl-Heinz Klima, hatte selbstverständlich das ganze Haus
zur Verfügung. Das galt gewiss auch schon für die ersten Hofgärtner,
Christian Ludwig Bosse und ab 1814 für seinen Neffen Julius Friedrich
Wilhelm Bosse, für die und deren Familien es gebaut und unterhalten
wurde. Nur als Herzog(sadministrator) Peter Friedrich Ludwig 1817
während der Renovierung seines Schlosses darin wohnte, wird der
Hofgärtner das Haus einige Zeit für seinen Herrn geräumt haben.
Entweder besteht man gemäß dem historischen Hintergrund also auf
voller Residenzpflicht der Gartenleiterin, dann ist dieser aber auch
entsprechend dem historischen Vorbild (und nach praktischem Verstand)
das ganze Haus zur Verfügung zu stellen, und zwar innen leidlich modern
gestaltet, denn die früheren Hofgärtner hatten auch ein jeweils
zeitgemäßes. Oder man will das Haus für Ausstellungs- und sonstige
Zwecke nutzen und damit die wahre historische Tradition eines reinen
Wohn- und Verwaltungsbaus stören. Dann muss die Gärtnerin aber woanders
in ordentlichen Verhältnissen leben können. Der Museumsdirektor haust
schließlich auch nicht in einer Nebenkammer des Schlosses.
Das
Hauptproblem in der Auseinandersetzung dürfte darin liegen, Frau
Stalling schon jetzt und ausschließlich ins unsanierte recht beengte
Obergeschoss zwingen zu wollen, was sich bereits aus organisatorischen
Gründen verbieten müsste, denn während der in diesem Jahr geplanten
Renovierung könnte sie dort ohnehin nicht wohnen. Wenn man stattdessen
die kulturellen Veranstaltungen in eines der Nebengebäude verlegte (oder
gar ein kleines Ausstellungshaus an der Mauer im Küchengarten neu
baute), bis zur Sanierung des Wohnhauses mit der Residenzpflicht warten
würde und Frau Stalling danach ein modern aber rücksichtsvoll
renoviertes historisches Einfamilienhaus, komplett inklusive Erdgeschoss
und mit größtem Garten der ganzen Stadt Oldenburg preisgünstig zur
Verfügung stellen würde, könnte sich nach Hoffnung des Verfassers der
Konflikt zu beider Seiten Wohlgefallen auflösen.
* * *
Wenige Tage später meldet die Presse unter
dem Titel Schlossgartenchefin darf doch bleiben (NWZ, Freitag,
23.2.2007, Nr. 46), man habe sich doch noch einvernehmlich einigen
können, womit die Kündigung sowie die Klage dagegen hinfällig werden.
Details waren nicht zu erfahren, aber die Hauptsache: Das Hofgärtnerhaus
wird auf Landeskosten renoviert und die Gartenleiterin
anschließend dort einziehen. Dies ist ganz im Sinne des Verfassers,
lässt sich
nun im Schlossgarten doch weiterhin gelebte Geschichte beobachten.
* * *
Vier Monate später erfuhren die
Zeitungsleser auch noch den Rest der Geschichte (NWZ, Donnerstag,
28.6.2007, Nr. 148, Stadt bekommt Schlossgarten-Museum): Im
Hochparterre des Schlossgärtnerhauses werden bis Frühjahr 2008 zwei
Ausstellungsräume zur Geschichte des Schlossgartens eingerichtet und der
Wohn- und Bürobereich vom Museumsteil durch eine Glaswand
abgetrennt. Die Schlossgartenchefin zieht ins Obergeschoss, darf aber
die Terrasse und den Küchengarten privat nutzen. Da scheint ein
tragfähiger Kompromiss gefunden worden zu sein, der beiden
Nutzungsansprüchen Raum lässt. Ein Gartenmuseum wird den Schlossgarten
zweifelsohne bereichern.
|
Martin Teller, 17. und 23.2., 1.7.2007 |
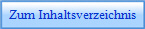 |
Unter den Eichen von Gut Drielake
Im Zuge der
Heidenwall-Ausgrabung und der geplanten Stadthafensanierung in
Oldenburg gerät der dazwischenliegende Hofplatz des ehemaligen
Gutes Drielake in den Blick, der historisch, möglicherweise
archäologisch und wegen des alten Eichenbestandes auch
ökologisch zu interessant ist, um ihn in einer Neubebauung
untergehen zu lassen. Entsprechende Gedanken hat der Verfasser
in einem Rundschreiben vom 30.9.2007 an einen Personenkreis
herangetragen, dessen Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen
mit der Thematik betraut sind, und deren Zusammenwirken
letztlich in Stadtbildpflege mündet.
Gut
Drielake im Sanierungsgebiet Alter Stadthafen
Landschaftsgeschichtlich passende Straßennamen
Sehr geehrte
Damen und Herren,
seit einiger
Zeit werden die Bürger der Stadt Oldenburg seitens Politik
und Verwaltung in die laufende Debatte zur Bebauung des
Stadthafens einbezogen. Weil dazu Mitte Oktober ein
städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben wird, möchte ich
als Historiker rechtzeitig einen Hinweis zur betreffenden
Siedlungslandschaft geben, dessen Berücksichtigung bei der
weiteren Geländegestaltung wünschenswert wäre. Ich habe ihn
einzelnen städtischen Verwaltungsmitgliedern und Archäologen
bereits im Zuge der Heidenwall-Grabung vorgestellt.
In der
Nordwest-Zeitung vom 11.9.2007 erschien eine Karte, die das
Sanierungsgebiet Alter Stadthafen umreißt, das ein Stück
östlich über das Bahngleis bei der Huntebrücke hinausreicht.
Möglicherweise noch innerhalb dieses Gebietes oder nur
wenige Meter östlich davon steht ein kleiner Hain mit hohen
Eichen, die das Gut Drielake umgaben. Dieser erstmals im
Spätmittelalter erwähnte Einzelhof, der den Grafen von
Oldenburg gehörte, wurde [Anfang] der 1990er Jahre
bedauerlicherweise abgerissen, ohne dass Haus und Gründstück
näher untersucht worden wären. Vor etlichen Jahrzehnten
wurde unter Historikern angenommen, das Gut könnte in
Zusammenhang mit dem etwa 1 km entfernten Heidenwall stehen
und ein zugehöriger Herrensitz gewesen sein. Da wir bislang
keinen sicheren Beleg für oder gegen diese These haben,
könnten vielleicht noch im Boden vorhandene (bei Umbauten
nicht beseitigte) Keramikreste Datierungsanhalte über die
Gründungszeit dieses Hofes liefern, der ein wichtiger
Kristallisationspunkt städtischer Entwicklung vom
Mittelalter bis zur Industrialisierung war. Insofern wäre es
sinnvoll, das kleine Areal mit den ohnehin schützenswerten
alten Eichen in die Stadthafen-Planungen einzubeziehen und
von jeglicher Bebauung auszunehmen.
Wenn der Ort
unangetastet bliebe, wäre es mit einer archäologischen
Untersuchung gar nicht eilig, die Stätte müsste lediglich
als dafür relevant vermerkt werden. Im Prinzip mache ich
hier den gleichen kostengünstigen und leicht umzusetzenden
Vorschlag wie anfänglich beim Heidenwall, das Flurstück
einfach als kleines Stadtgrün im Hafenbereich liegenzulassen.
Auf der
beigefügten Karte von Anfang[/Mitte] der 1990er Jahre ist das jetzt
verschwundene Gutshaus rot [umrahmt, ein jüngeres auch
abgerissenes Wohnhaus rot] unterlegt und die Umgrenzung
seiner Hofparzelle rot markiert.
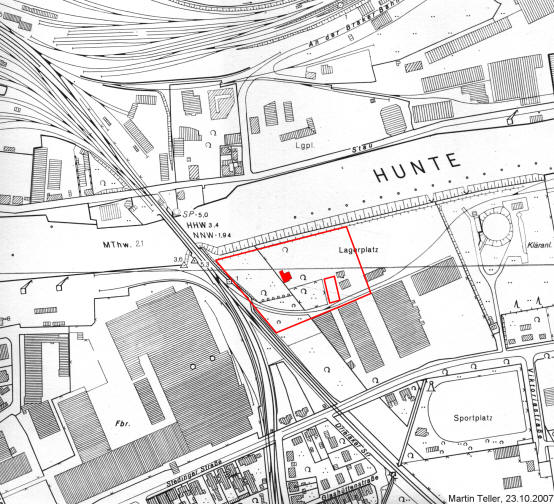
Lageplan des abgebrochenen
Gutes Drielake in
Oldenburg-Drielake auf dem Gelände der ehemaligen
Wagenbauanstalt, später Fa. Haniel & Co., jetzt Macco-Lager (mit
ggü. dem Brief präzisierten Einträgen nach weiterer
Forschung). Die historischen Hofländereien waren
deutlich größer, sie reichten bis an die heutige Stedinger
Straße und westlich über die Gleise hinaus. Markiert ist nur der unmittelbare Hofbereich, in dem
vielleicht noch datierbare Hausreste im Boden zu finden
wären. Bearbeitung von Teilen der Deutschen Grundkarte
1:5.000 Nr. 2815, -21 durch Martin Teller, 30.9./23.10.2007.
Bei der Gelegenheit
möchte ich die dafür Zuständigen noch einmal auf meine
aktuellen historisch-landschaftlich passenden
Straßennamensvorschläge hinweisen und um deren
Berücksichtigung bitten. Die Stadt hat sich offiziell zur
Maxime gemacht und in einem Verwaltungsverfahren
festgeschrieben, bei neu zu vergebenden Straßenbezeichnungen
zuerst an alte Flurnamen und geschichtliche Ereignisse zu
erinnern. Wie schon im Historienspiegel auf meiner Homepage
dargestellt [beim Aufruf
zum Schutz des Heidenwalls], habe ich entsprechend für
die neue Straße um IKEA zwischen Holler Landstraße und
Werrastraße den Flurnamen Wesenbrok vorgeschlagen
(analog zu Ellernbrok usw.). Angesichts der geschichtlichen
und archäologischen Bedeutung des in diesem Flurstück
liegenden Heidenwalls wäre es aber durchaus angemessen, die
Straße alternativ Am / Beim Heidenwall zu
nennen. (Die Bezeichnung Heidenwallweg wäre
demgegenüber ein Scherz, wäre der Wall ohne mein Engagement
doch beinahe „weg“ gewesen.)
Die Haupterschließungsstraße des Flughafengeländes sollte
gemäß dem wichtigsten dortigen Flurnamen Alexanderheide
genannt werden, was ich hiermit vorschlage. Vor Anlage des
Flughafens erstreckte sich hier eine weite „zivile“ Heide,
die seit dem 17. Jahrhundert aber auch als Exerzierplatz
genutzt wurde. Solche geschichtlich verwurzelten Namen
sollten bei allen Oldenburgern, die an einem individuell
unverwechselbaren Gesamtbild ihrer Stadt interessiert sind,
auf Zustimmung stoßen.
Mit
freundlichen Grüßen
Martin
Teller
Verteiler:
- Oberbürgermeister Prof. Dr. Gerd Schwandner
- Bezirksarchäologin Dr. Jana Fries
- Rats- und Bauausschussmitglieder Ursula Burdiek, Alexandra
Reith, Gerd Hochmann, Hans-Richard Schwartz
- Kulturdezernent Martin Schumacher
- Baudezernent Dr. Frank-Egon Pantel
- Leiter des Amtes für Verkehr und Straßenbau Hans-Joachim
Schatke
- Leiter des Amtes für Umweltschutz und Bauordnung Klaus
Büscher
- Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde Friedrich Precht
- Stv. Direktor des Stadtmuseums Udo Elerd
- Bürgervereinsvorsitzende von Neuenwege Birgit Kempermann
- Bürgervereinsvorsitzender von Osternburg-Drielake Helmut
Schultheiß

Oben: Das abgebrochene
Wohnhaus von Gut Drielake (im Lageplan rot unterlegt), Stedinger
Straße 141 a, Südost-Ansicht.
Im Hintergrund der südliche Arm der zweigleisigen
Eisenbahn-Klappbrücke über die Hunte (Baujahr 1952/53). Aufnahme
Herbst/Winter 1953 oder 1954.
Unten: Aus dem Nebel der Geschichte – der wohl nur selten
fotografierte rückwärtige Nordgiebel und ein Teil der Westseite
des viel älteren ebenfalls abgebrochenen Gutshauses Drielake
(Bauernhaus, dessen einstiger Standort im Lageplan rot umrahmt),
Bildausschnitt von 1954.
Fotos freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. Alf
Dieterle, dessen Familie in den 1950er Jahren in der
Parterre-Wohnung des Wohnhauses lebte.
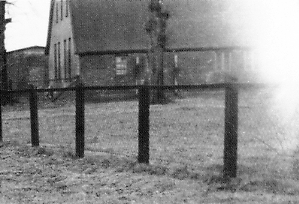
Wie sich
inzwischen herausgestellt hat, liegt der alte Drielaker Hofplatz
gerade außerhalb des bisher geplanten
Stadthafensanierungsgebietes. Dennoch kann es nicht schaden,
frühzeitig auf bedeutsame Stätten innerhalb der ausgedehnten
Oldenburger Stadtviertel aufmerksam zu machen. Was wir letztlich
unter den Eichen von Drielake finden würden, ist noch gar nicht
ausgemacht. Wenn es keine stadtgeschichtlich bedeutsamen Funde
sondern nur ein wenig Erholung in einem Kleinpark sein sollte,
wäre das auch schon etwas.
In die gleiche Richtung zielen die Straßennamensvorschläge, die
zu einem gefälligen weil ortsindividuell "stimmigen" Stadtbild
beitragen sollen. Es sei daran erinnert, dass sich auf Flurnamen
bezogene Straßennamen nicht beliebig innerhalb der Stadtteile
verschieben lassen, wie das bei Personennamen meistens möglich
ist. Wenn wir schon einmal das seltene Glück haben, einen echten
Flurnamen oder einen wiederaufgefundenen Geschichtsort in einem
Straßennamen würdigen zu können, dann müssen wir das an seiner
einzigartigen historischen Stätte tun.
|
Martin Teller, 17. 10.2007 |
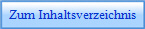 |
Alte Gärten, neue Höfe
Nördlich des
Oldenburger Wallringes wurde 2006-2008 das gesamte Areal
zwischen Heiligengeiststraße, Georgstraße und Finanzamt neu
beplant und bebaut. Für die dort entstandene Straße schlug der
Verfasser einen historisch stimmigen Namen vor, der sich passend
in das moderne Stadtbild einfügen würde: Schanzengärten.
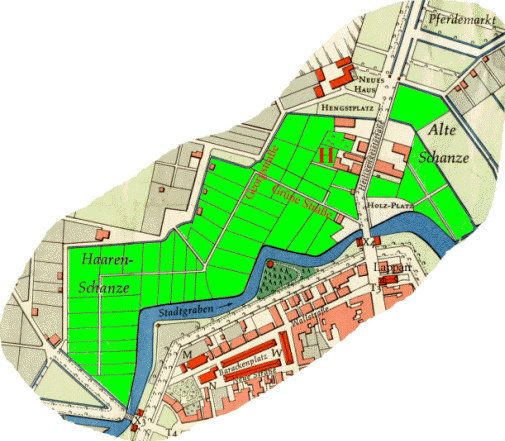
Mitten in den einstigen
Schanzengärten (grün) liegt das
moderne Gebäudeensemble „Heiligengeisthöfe“ (um
H). Ausschnitt aus der Karte
„Oldenburg mit Umgebung 1821“, Niedersächsischer Städteatlas III
(Oldenburgische Städte) A 2, hrsg. von der Historischen
Kommission für Niedersachsen, Oldenburg 1961. Bearbeitet von
Martin Teller, 4.2.2008. Die nachgetragenen zwei Straßennamen
sind offizielle Benennungen der 1840er Jahre.
Brief des
Verfassers vom 17. Januar 2008, Ratsvorlage für den
Verkehrsausschuss der Stadt Oldenburg, der für
Straßennamenbenennungen zuständig ist:
Neuer
Straßenname im Neubaugebiet Heiligengeiststraße
Sehr geehrte
Damen und Herren,
gestatten
Sie mir einige Worte zu den im Bau befindlichen
Heiligengeisthöfen, bei denen auch eine noch zu benennende
Straße entsteht. Wie ich erfahren habe, wünscht der Investor
wohl einen entsprechenden Straßennamen, um damit Reklame für
sein Bauprojekt zu machen. Solch reinen Marketingnamen, die
meist nur den Augenblick des Verkaufs oder der Vermietung im
Sinn haben, sollten wir grundsätzlich sehr kritisch
gegenüberstehen, wenn wir die langfristige Wirkung von
Namensgebungen im Stadtbild beachten.
Historisch-landschaftlich gewachsene Bezeichnungen sind
immer künstlichen vorzuziehen, die niemals denselben Grad an
lokaler Originalität erreichen und nur Notlösungen an
„geschichtslosen“ Orten darstellen können. Das sieht die
Verwaltung ähnlich und hat sich darum zum Ziel gesetzt,
Flurnamen und Geschichtsbezeichnungen in Straßennamen zu
erhalten.
Nun kann man aus ästhetischen Gründen nichts gegen einen
Namen „Heiligengeisthöfe“ haben, weil „Hof“ stets Urbanität
betont, was am nördlichen Innenstadtbereich eindeutig
zutrifft. In Verbindung mit „Heiligengeist“ suggeriert der
Name allerdings die historisch falsche Annahme, in dieser
Gegend habe sich im Mittelalter ein „Heiligengeistviertel“
um die Heiligengeistkapelle (Lappan) befunden, dabei
erstreckten sich am Ort des Neubaus bereits die
außenliegenden Verteidigungsanlagen.
Ein überlieferter spätfrühneuzeitlicher Flurname nennt die
damalige Gärtenlandschaft in den geschleiften
Festungsanlagen Schanzengärten, und so (vielleicht
mit dem schönen Zusatz „In den“) sollte die hier entstandene
Straße am besten auch heißen. Man beachte die benachbarte
Grüne Straße, die ebenfalls Bezug darauf nimmt. Im
Schriftwechsel mit dem zuständigen städtischen
Sachbearbeiter Herrn Aden habe ich als Kompromiss
Schanzenhöfe vorgeschlagen, weil Hof/Hoff im
Plattdeutschen eben auch Garten bedeutet. Der Investor
könnte dann an der Hausfront zur Heiligengeiststraße immer
noch ein Schild „Heiligengeisthöfe“ anbringen, was sich eben
nur auf die heutigen Gebäude bezieht. Um historischen
Flurnamen und modernen Gebäudekomplex am deutlichsten
unterscheiden zu können, wäre freilich die Kombination von
Schanzengärten für die Straße und „Heiligengeisthöfe“
für die neuen Häuser ideal. (Die gesamte Baulichkeit hieße
dann „Heiligengeisthöfe in den Schanzengärten“).
Mit diesem
Schreiben wende ich mich an Frau Multhaupt von der SPD, Frau
Reith von den Grünen und Herrn Schwartz von der FDP, weil
sie Interesse an stadtgeschichtlichen Belangen und an zu
Oldenburg passenden Straßennamen gezeigt haben. Ich hoffe,
in der CDU-Fraktion und bei den Linken ebenfalls
entsprechende Ansprechpartner zu finden. Über allgemeine
Unterstützung dieser fachlichen Beratung würde ich mich wie
stets sehr freuen.
Man muss sich
einbringen, wenn man etwas beizutragen hat, auch wenn es
zuweilen einige Mühe macht. Eine demokratische Gesellschaft
beruht eben auf Bürgerbeteiligung. Dem Schreiben sind noch
einige Gedanken nachzutragen.
Unerwartet mag
das Geständnis des berufsgemäß geschichtsbewussten Verfassers
sein, private stadtbauliche Initiativen generell zu bewundern
und die Schaffung neuer Baulichkeiten vielfach zu begrüßen. (Die
Bewertung einzelner Bauvorhaben hängt natürlich von deren
Gestaltung ab, und davon, ob sie sich stimmig in das gesamte
Stadtbild einfügen, was Rücksichtnahme auf historisch
Gewachsenes einschließt.) Auch ist die Namensneuschöpfung
„Heiligengeisthöfe“ (nach Privatmeinung des Verfassers) durchaus
schön; jedenfalls nicht so völlig unpassend wie die jungen
Bezeichnungen „Burghöfe“ und „Am Cäcilienhof“ – beides
historisch unkorrekte Kunstnamen, die alte Flurnamen überfahren
und nur temporäre Marketingobjekte darstellen, die aber späteren
Generationen dauerhaft im Stadtbild hinterlassen werden.
Hier im Norden
der Altstadt gibt es zwar den historisch belegten Begriff „Außer
dem Heiligengeisttor“, mit dem alles städtische Weideland
außerhalb des Tores bei der Heiligengeistkapelle bezeichnet
wurde. Die so benannte Gegend erstreckte sich nördlich
allerdings bis zum Bürgerbusch und endete im Westen in dem
Bereich, wo gefühlsmäßig die Gegend „Außer dem Haarentor“
anfing. Beide Begriffe sind reichlich ungenau und stellen keine
Lokalität, keinen Flurnamen im engeren Sinn dar, wie zum
Beispiel der Melkbrink, auch keinen „Hof“ im Sinne von Garten,
wie die mittelalterlichen Höfe von Bürgern und Geistlichen auf
dem Ehnernesch, worunter hier natürlich kein Bauernhof oder
Stadthof zu verstehen ist, die es in dieser früher fast
gebäudefreien Gegend nicht gab.
Dagegen hält der nach Schleifung der Wälle aufgekommene Flurname
Schanzengärten die historische Landschaftssituation zu
Beginn des 19. Jahrhunderts fest, worauf bereits der verstorbene
Straßennamenexperte Friedrich Schohusen aufmerksam gemacht hat.
(Die Oldenburger Straßennamen, Band 1, Oldenburg 1977, Artikel
Grüne Straße, S. 96-97.) Um diesen originalen und originellen
Flurnamen im Stadtbild zu erhalten, hat der Verfasser ihn als
Straßennamen vorgeschlagen. Bekanntlich war Oldenburg rings um den
Innenstadtkern von später abgetragenen und bebauten Schanzen
umgeben, die besonders nach Norden eine ausgedehnte Fläche
einnahmen. In dem hier entstandenen Viertel befinden sich eine
Reihe bedeutender öffentlicher und privater Bauten –
Peter-Friedrich-Ludwigs-Hospital, Wallschule, St. Peter-Kirche,
Pius-Hospital, NWZ-Hochhaus, Garnisonkirche, ehem. Lehrerseminar
(Staatshochbauamt), Finanzamt, Kaufhaus CCO, Stadtmuseum –, die
dazu beitragen, Oldenburg ein individuelles Gesicht zu geben.
Solche Individualität wünscht man sich auch bei unseren
Straßennamen, die, wenn sie sich von typischen Straßennamen
anderer Städte oder von überall möglichen reinen Kunstbezeichnungen unterscheiden
wollen, eben Bezug auf unsere Geschichte und hier gewachsene
Namen nehmen müssen. Ein Straßenname „(In den) Schanzengärten“
passt zu den benachbarten Wallanlagen, dem gliedernden
Grüngürtel um die Altstadt, der sich großer Wertschätzung
erfreut. Die Thematik „Umwandlung militärischer Schanzen in
bürgerliche Gärten“ passt auch allgemein zur Gartenstadt
Oldenburg, berücksichtigt gleichzeitig ihre Geschichte als
Festungsstadt und ihr architektonisch bedeutsames Wachstum im
Verlaufe des 19. Jahrhunderts.
Übrigens hatte
der Verfasser im Schriftwechsel mit der Stadt Sommer 2006
mehrere geschichtlich passende Straßenbezeichnungen erwogen
(etwa einen Bezug zum ehemals benachbarten Neuen Haus, einstige
Gastwirtschaft, heute dort das Finanzamt) und vorgeschlagen,
hier zwei Straßennamen zu vergeben. Das böte auch die
Möglichkeit, den hinteren Straßenteil nach den Schanzengärten
zu benennen, während der zur Heiligengeiststraße gelegene dann
durchaus Heiligengeisthöfe genannt werden könnte. Wenn es
aber nur einen Straßennamen geben soll, ist nach dargelegter
Auffassung immer das geschichtlich Originale vorzuziehen. Doch
spricht überhaupt nichts dagegen, die neue Gebäudegruppe
unabhängig vom Straßennamen als „Heiligengeisthöfe“ zu
bezeichnen und dies auch durch einen Schriftzug an den Häusern
kenntlich zu machen. Durch Verwendung des Flurnamens unter
Einbeziehung des vom Investor bevorzugten Namens für die
Gebäude entstünde der Stadt kulturell, stadtbildlich und auch
nach Marketinggesichtspunkten („urbanes Wohnen/Handeln bei nahem
Stadtgrün“) ein Mehrwert. Außerdem ließe sich so
privatwirtschaftliches Engagement würdigen, ohne dabei
wirtschaftlich legitimes Gewinnstreben als absoluten Maßstab zu
begreifen und ihm so die Rolle des Heiligen Geistes
zuzuschreiben, an den derart benannte Höfe doch eigentlich
erinnern sollten.
|
Martin Teller, 4.2.2008 |
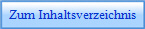 |
Historische Wohntradition im
Schlossgarten
●
Unter den
Eichen von Gut Drielake
●
Alte
Gärten, neue Höfe
|